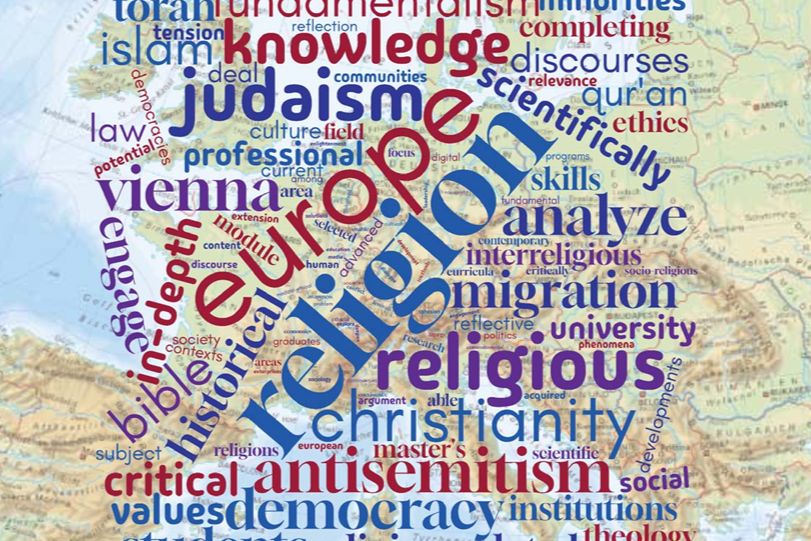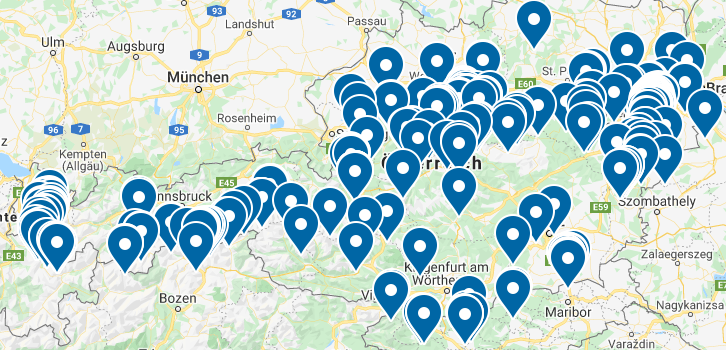300 Jahre Immanuel Kant: Gott denken in den Grenzen der Vernunft

Foto: Johann Gottlieb Becker (Maler), via Wikimedia Commons
Podcast vom 19. Dezember 2024 | Gestaltung: Henning Klingen*
Religion. Gott. Glaube: Das sind doch Dinge, die da anfangen, wo die Vernunft und Ratio aufhören, oder? Wenn sonst nichts mehr hilft, beginnen Menschen zu beten. Wenn es nichts mehr zu erwarten gibt, setzt religiös imprägnierte Hoffnung wider alle Hoffnung ein. Die Hoffnung auf Erlösung zum Beispiel. Die Claims sind sozusagen abgesteckt.
Aber das ist vielleicht doch nur die halbe Wahrheit. Denn seit Menschen Gott sagen, denken sie auch darüber nach, warum es sinnvoll ist oder auch unsinnig ist, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Glaube ist vernünftig, lautete zum Beispiel die Überzeugung von Papst Benedikt XVI. Es war auch eine Grundüberzeugung vieler Denker durch die Jahrhunderte bis zu Beginn der Neuzeit hinein.
Dann ist allerdings etwas passiert: Mit der Entstehung des modernen Subjektbegriffs, mit der Befreiung des Ich durch die Aufklärung, stand dieses Ich plötzlich allein und nackt da. Es konnte, es musste sich verhalten - zur Welt, zur Gesellschaft, den Mitmenschen, zur Idee, dass es einen Gott gibt - oder eben auch nicht. Kurzum: In dieser Zeit ist etwas aufgebrochen: Zweifel. Und einer, der in dieser Zeit die Brechstange in der Hand hielt, war Immanuel Kant. 1724, vor 300 Jahren in Königsberg geboren und 1804 ebendort gestorben.
Kant und die Welt des 18. Jahrhunderts
Über ihn und sein Nachdenken über Religion und Gott wollen wir heute sprechen bei "Diesseits von Eden". Und dazu begrüße ich zum einen Christian Danz. Er lehrt als Professor für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien. Dann begrüße ich Christoph Amor. Er ist Professor für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen, wo zuletzt auch eine Tagung über Kant und die Theologie stattgefunden hat. Und schließlich von der Katholischen Privat-Universität (KU) in Linz begrüße ich Franz Gruber, Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie.
Prof. Danz, vielleicht können Sie uns zunächst ein wenig einführen in die philosophisch-theologische Welt des 18. Jahrhunderts. Was war das für eine Welt aus religiöser, aus theologischer Perspektive?
Danz: "Die Welt des 18. Jahrhunderts war eine Welt des Umbruchs, der gesellschaftliche Modernisierung. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass die christliche Religion eben nicht mehr den übergeordneten Rahmen des Weltbildes darstellte, sondern eine kulturelle Form neben anderen. Das hat wiederum zur Folge gehabt, dass das Verständnis dessen, was Religion ist, unklar geworden ist. Welche Funktion hatte Religion noch für den Menschen, für die Kultur, für die Gesellschaft? Und in diesem Horizont der europäischen Aufklärung schreibt Kant seine Philosophie. Auf der einen Seite ist diese Philosophie erkenntniskritisch: Der Mensch kann nur etwas wissen, von dem er Anschauung und Begriff hat. Nun haben wir zwar einen Begriff von Gott, aber eben keine Anschauung. Und damit fällt der Gottesgedanke aus dem Bereich der möglichen Erkenntnisgegenstände heraus. Kant, der - wie Heinrich Heine das dann später formuliert hat - den lieben Gott über die Klinge hat springen lassen, führte dann den Gottesgedanken in der praktischen Philosophie wieder ein als Bestandteil nicht der Begründung der Moral, sondern der Realisierung der Moral. Dass also Religion was mit Moral zu tun hat, ist eine Auffassung, die in der Aufklärung üblich war. Es gab natürlich auch andere Auffassungen - dass Religion etwas mit Gefühl zu tun hat, mit Innerlichkeit. Aber Kant fasste im Grunde diese Bewegung zusammen, aber auf einer neuen Grundlage."

Prof. Christian Danz
War Kant somit ein Katalysator einer geistesgeschichtlich breiten Bewegung seiner Zeit?
Danz: "Ja, ich würde sagen, er ist eine Art Katalysator. Das Neue seiner Philosophie ist die Transzendentalphilosophie. Die wird zum Ausgangspunkt all dessen, was wir als 'Deutschen Idealismus' bezeichnen. Im Hinblick auf die Religion das wahrscheinlich gar nicht mal so neu - denn viele Theologen vor Kant haben schon Religion mit Moral verbunden. Aber seine Transzendentalphilosophie schafft dann einen einheitlichen Rahmen, um überhaupt von Gott sprechen zu können. Denn durch die Erkenntniskritik ist eben der Gottesgedanke als allgemein zugängliche Grundlage weggefallen."
"Nach wie vor ein Stachel im Fleisch der Theologie"
Christoph Amor, Sie haben bei der Tagung in Brixen einen Vortrag unter dem schönen Titel "Sag, wie hältst du's mit der Religion?" gehalten. Ist das eine Frage, die Sie zugleich Kant gestellt haben? Wie also hat es denn Kant selber mit der Religion gehalten?
Amor: "Aufgrund seiner religiösen Sozialisation im christlichen Umfeld war Kant im weitesten Sinne zunächst einmal mit dem Christentum von klein auf vertraut. Und angesichts eines militanter werdenden Atheismus' oder eines vorrückenden religiösen Indifferentismus würde Kant wohl sagen: Für einen reflektierenden Menschen bleibt die Gottesfrage nach wie vor ein relevantes Thema. Es ist ein Thema, das die Vernunft nicht los wird - auch nicht im Blick auf die Frage, wie ein sittliches Leben geführt werden kann. Wie motiviert man sich in einer Welt, in der die Guten allzu oft die Dummen sind und die Schlitzohren am Ende ungeschoren davonkommen? Bei diesen Überlegungen ist Kant nach wie vor aktuell. Aber ich finde auch die 'Nebenschauplätze' interessant – und da ist Kant meines Erachtens nach wie vor ein Stachel im Fleisch, wenn er der Theologie unangenehme Fragen stellt. Zum Beispiel die Frage, wie wir es mit den sogenannten Gottesbeweisen halten. Das war in der damaligen Zeit eine 'heiße' Frage, in der er sehr forsch aufgetreten ist. Die christliche Apologie hat ja behauptet, wer nicht an die Existenz Gottes glaubt, ist entweder zu dumm, um die Beweise zu verstehen, oder sittlich verstockt. Dagegen war Kant eine heilsame Infragestellung. Die zweite Frage, die er den Kirchen auch heute noch stellt, lautet: Wollt ihr wirklich Gott verteidigen gegenüber dem Vorwurf, nicht liebend oder nicht gerecht zu sein? Er fordert also eine Antwort auf die klassische Theodizeefrage – wobei Kant da ganz klar sagt: Ein Mensch kann Gott in dieser Frage nicht verteidigen, er muss sich selber rechtfertigen angesichts einer Welt, die nicht danach aussieht, dass ein gütiger, gerechter Gott gleichsam schützend die Hand über sie hält. Also wie können wir in einer solchen Welt an Gott glauben? Das ist, denke ich, eine nach wie vor brandaktuelle Frage."

Prof. Christoph Amor
Ich hatte es bisher immer so verstanden, dass Gott als Postulat, letztlich also als Erfordernis auftaucht - und zwar genau an dieser Stelle, wo das Böse und die Ungerechtigkeit betrachtet werden: Weil eine Welt, in der tatsächlich das Unrecht oder die Bösewichte obsiegen, nicht auszuhalten wäre ohne einen rettenden Gott …
Amor: "Wenn Kant betont, dass es sich bei Gott um ein Postulat handelt, dann will er damit die Apologetik herausfordern und sagen: Ist der Anspruch gerechtfertigt, den ihr in einer klassischen Theodizee erhebt, nämlich dass wir gleichsam Gott auf die Finger schauen können, dass wir Gründe Gottes namhaft machen können, die einen heiligen, gerechten, weisen Schöpfer dazu motivieren, nicht einzugreifen oder bestimmte Dinge zuzulassen? Dazu würde Kant sagen: Woher nehmen wir erkenntnistheoretisch gesehen das Recht zu behaupten, wir können gleichsam Gott ins Fenster schauen? Er würde nachbohren und fragen, auf welcher Grundlage wir Gott verteidigen."
"Es steckt viel mehr Kant in der Theologie, als man gemeinhin meint"
Damit haben Sie jetzt die Rutsche zu Franz Gruber gelegt und zur Frage des heutigen Nachdenkens über Gott. Herr Gruber, wo spielt denn in der Theologie die Kantische Philosophie heute eine Rolle?
Gruber: "Zunächst muss man sagen, dass die katholische Kirche, gerade im 19. Jahrhundert, extreme Schwierigkeiten mit Kant hatte. Das Werk kam auf den Index der verbotenen Bücher. Und selbst beim Ersten Vatikanischen Konzil (1869/70) wurde noch klipp und klar gegen Kant festgehalten: Der Mensch kann mit der natürlichen Vernunft Gott erkennen - und zwar in seinen Wirkungen, also in der Schöpfung. Das war noch einmal ein apologetischer Gegenschlag mit dem damals auch restituierten Neuthomismus, das heißt also die thomistische Theologie wurde als Bollwerk gegen diese Kantische und die Philosophie des deutschen Idealismus eingesetzt. Und es brauchte sozusagen den besten Theologen des 20. Jahrhunderts, nämlich Karl Rahner, um diese Blockade gegenüber dem Kantischen Paradigma aufzubrechen. Rahner ist der einzige gewesen, der auf seine eigene geniale Art und Weise versucht hat, die Erkenntnistheorie des Thomas von Aquin aus der Kantischen Perspektive der Transzendentalphilosophie zu lesen. Rahner ist es damit gelungen, diese Frage der Möglichkeitsbedingungen des Glaubens und der Rede von Gott neu aufzustellen. Und Rahner war derjenige, der diese anthropologische Wende für die Theologie durchgeführt hat. Seine beiden frühen Werke – "Geist in Welt" und "Hörer des Wortes" – sind gleichsam für die katholische Theologie die maßgeblichen Rezeptionsvorgänge des Kantischen Denkens gewesen. Und das ist eigentlich mit Rahner dann auch ins offizielle Denken der katholischen Kirche hinein gegangen. Das heißt, es steckt viel mehr Kant in der katholischen Theologie, als man gemeinhin meint."
Jetzt sind wir schon sehr theologisch, sehr philosophisch geworden. Vielleicht gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück - und auf die Ebene gelebten Glaubens. Wäre die Art, wie wir heute Glauben leben hier in Mitteleuropa, eigentlich eine andere, wenn es Kant nicht gegeben hätte?
Danz: "Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, man muss sich vor Augen halten, dass Kant noch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation lebte – das heißt in einem Reich, in dem es keine Religionsfreiheit gab. Es gibt sozusagen in jedem Land des Deutschen Reiches eine Konfession, die anderen sind quasi vertrieben, sozusagen. Das lässt sich mit unserer Situation heute überhaupt nicht vergleichen. Wir haben Leben in einer demokratischen Gesellschaft mit eingeschrieben oder mit Religionsfreiheit usw. Wir leben in einer extrem ausdifferenzierten Gesellschaft, wo diverse Kulturen und Religionskritiker nebeneinander leben. Das lässt sich alles gar nicht vergleichen. Deswegen ist natürlich die Frage Wie hält es Kant mit der Religion ganz anders zu beurteilen als bei uns, weil es ja in einem Rahmen ist, wo die Religion doch eine sehr dominante Rolle spielt. Dieses Gesetz, also sozusagen die nur die Religionen oder Konfessionen, die auf dem Boden der Konfession Augustana stehen, sind ja im Deutschen Reich anerkannt, alle anderen das ja gar nicht geben. Also das lässt sich gar nicht vergleichen mit uns. Deswegen haben wir natürlich eine hoch plurale und auch eine hoch individualisierte Religion. Selbst im Katholizismus ist das natürlich die offizielle kirchliche Lehre. Die deckt sich ja nicht mit dem, was die Frau, was die Glaubenden sozusagen teilen. Das ist natürlich im Protestantismus genauso, das ist wahrscheinlich noch pluralisierter, aber das lässt sich, glaube ich, nicht vergleichen."

Prof. Franz Gruber
Mit Kant über Kant hinausdenken
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird Gott von Kant innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft gedacht. Das heißt, Gott wird begrifflich sozusagen eingehegt. Muss man da theologisch nicht gegen aufbegehren, wenn man doch bekennt, dass Gott dasjenige sein soll, über das hinaus nichts Größeres denkbar ist...?
Gruber: "Ja, natürlich. Also das war ja auch von Anfang an das Problem. Schleiermacher zum Beispiel reagiert schon darauf, dass die Frage der Begründung der Religion aus der Moralität heraus dem Phänomen der Religion und dem Gottesglauben nicht entspricht. Andererseits ist die Moral ein wichtiger, aber nicht der einzig mögliche Zugang zur Wirklichkeit Gottes. Wir könnten auch aus der Schöpfungslehre, aus der Erfahrung der Natur, aus der Erfahrung der Wirklichkeit heraus genauso diese Begründung der Wirklichkeit Gottes denken. Und wenn wir an die abendländische Metaphysik denken, dann kommt diese nicht von der Ethik her, sondern von der grundsätzlichen Offenheit des Menschen auf die Wirklichkeit. Was aber mit dem neuzeitlichen Paradigmenwechsel entscheidend geworden ist, ist die Dimension des autonomen Subjekts. Das heißt also dieses Selbstbewusstsein des Menschen, dessen Vernunft die Möglichkeitsbedingung von Erkenntnis überhaupt ist. Das stellt die bisherige klassische Dimension von Sein und Erkennen auf andere Geleise: Gott ist vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis nicht mehr einfach rezipierbar, sondern die kritische Erkenntnis fragt: Was heißt Gott? Wie kommst du auf so einen Begriff oder eine Wirklichkeit? Und genau an diesem erkenntniskritischen Punkt kann man auch ethisch argumentieren - also mit der Grunderfahrung der Freiheit des Menschen. Genau das hat Kant getan wie kein anderer zuvor: Er hat klar gemacht, dass die Vernunft des Menschen ein Phänomen der Freiheit ist. Und diese Autonomie ist letztlich dann natürlich auch die Grundlage für Moralität und für Sittlichkeit, aber eben auch die Brücke zum Glauben oder besser gesagt zum Gottesbegriff."
Amor: "Ich würde auch sagen, es hat diesen Aufschrei und Protest gegeben - allerdings wohl weniger 'diskursiv' als vielmehr derart, dass Kant in den 'Giftschrank' kam. So musste man sich nicht damit auseinandersetzen. Andererseits könnte man sagen: Was wir von Kant gelernt haben bzw. auch heute noch lernen sollten, ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen Gott und unseren Gottesbegriffen. Das heißt, wenn wir Theologie treiben wollen, müssen wir zunächst Anthropologie betreiben und uns fragen: Wie sind denn unsere Zugänge zu diesem Geheimnis, das wir Gott nennen? So verstanden möchte Kant die Theologie darauf hinweisen, dass sie Methoden und Erfahrungsorte offenlegen soll."
Einer der neuzeitlichen Philosophen, die sich als Erben Kants verstehen und ebenfalls über Religion und Theologie nachdenken, ist Jürgen Habermas. Bei ihm braucht es aber Gott schon nicht mehr in der Moral - da geht alles über die Diskurs(ethik)schiene. Das Kantsche Gott-Postulat ist überflüssig geworden, könnte man sagen. Braucht es den Gottesgedanken im heutigen Nachdenken der Philosophie überhaupt noch?
Danz: "Wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte das noch einmal präzisieren: Der Gottesgedanke spielt keine begründende Rolle in der Kantischen Philosophie, auch nicht in der Moralphilosophie! Die Grundlage ist die Moral, die Autonomie. Der Punkt, an dem Kant den Gottesgedanken einführt, ist die Realisierung der Moral, das heißt die Anwendung des Sittengesetzes. Das heißt Gott oder der Gottesgedanke repräsentiert quasi im Handeln des Menschen, dass das sittliche Handeln voraussetzt, dass die sittliche Freiheit des Menschen mit der Naturnotwendigkeit kompatibel sein muss. Das repräsentiert Gott also, aber es begründet gar nichts. Religion ist für Kant also eigentlich nichts anderes als Ethik."
Kant-Lesetipps für Theologie-Studierende
Im Blick auf unsere Hörerinnen und Hörer aus dem studentischen Milieu: Was würden Sie denen denn an Lektüre-Tipps ans Herz legen, um sich der Frage nach Kant, Gott und Theologie zu nähern?
Danz: "Wünschenswert wäre natürlich, die "Kritik der reinen Vernunft" zu lesen, weil das gewissermaßen die Grundlage für alles ist. Man versteht eigentlich die Religionsschrift gar nicht ohne die Kritik der reinen Vernunft. Für die Religionsphilosophie ist sicherlich die "Kritik der praktischen Vernunft" wichtiger als die Religionsschrift und wohl auch ein guter Einstieg."
Amor: "Aus katholischer Sicht könnte man auf ein Büchlein hinweisen, das kürzlich die Kollegen Rudolf Langthaler und Magnus Striet veröffentlicht haben: "Vernunftreligion statt Kirchenglaube"; darin geht es um Kants unerledigte Anfragen an die Theologie, so der Untertitel. Darin wird recht präzise herausgearbeitet, wo die Baustellen sind, die Kant einer christlichen Theologie hinterlassen hat. Baustellen, die zum Teil noch unerledigt sind. Und gerade jetzt, also im Blick auf das Jubiläumsjahr, stellen die Autoren fest: Es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig katholische Theologie – sei es im Bereich der Christologie, im Bereich des Bittgebets, im Bereich der Erlösungslehre – sich wirklich intensiv mit Kant auseinandergesetzt hat. Ein lesenswertes und auch nicht zu dickes Buch …"
Gruber: "Also ich empfehle Studierenden: Macht ein Kant-Seminar. Das war für mich als Student auch brutal, aber da bekam ich sozusagen das Rüstzeug, das man für das Denken braucht. Weiters empfehle ich ein kleines Buch von Eckart Förster, "Die 25 Jahre der Philosophie". Darin beschreibt Förster die Jahre zwischen Kant, der gesagt hat, bis zu ihm habe es überhaupt keine Philosophie gegeben, und Hegel, der nur 25 Jahre später sagte, mit ihm ende die Philosophie. Das ist eine spannende Darstellung dieser gesamten Transzendentalphilosophie in diesen 25 Jahren. Wenn man das Buch verstanden hat, dann hat man wirklich diesen ganzen Kontext und Umbruch dieser Jahre verstanden. Wenn man sich das als Studentin bzw. als Student aneignet, hat man was für das nächste Jahrhundert."
Was für das nächste Jahrhundert … Ich weiß nicht, ob Studierende in diesen Zeiträumen denken. Aber auf jeden Fall halten wir den Aufruf fest: Besucht ein Kant-Seminar! Vielen Dank in die Runde für dieses informierte Gespräch. Und falls auch Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal – bis dahin sage ich: vielen Dank fürs Zuhören!