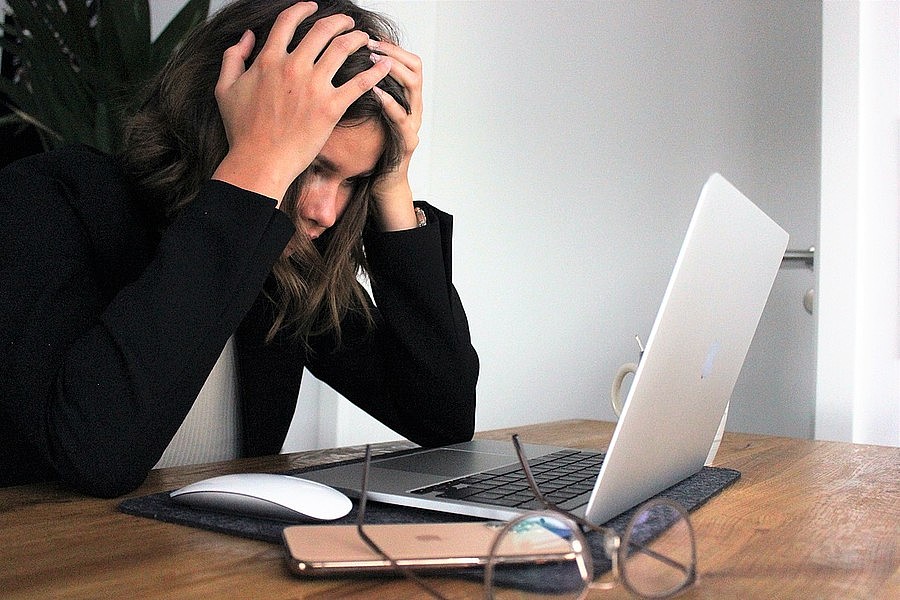Internationalisierung, Kooperationen, Profilbildung? - Theologische Fakultäten suchen nach Wegen in die Zukunft

Foto von Roman Kraft auf Unsplash
Zustimmung erforderlich!Bitte akzeptieren Sie Cookies von "simplecast" und laden Sie die Seite neu, um diesen Inhalt sehen zu können.
Podcast vom 15. März 2024 | Gestaltung: Henning Klingen*
Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Eden, dem Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich, diesmal live und in Farbe aus der Uni Wien. Dort treffen sich nämlich aktuell die Dekane und Dekaninnen der forschungsstarken Universitäten Europas in den Bereichen Theologie und Religious Studies. Diese Gruppe, die GILD -Gruppe, hat sich in Wien darüber ausgetauscht, unter anderem, wie man die Theologie für attraktiver oder attraktiv gestalten kann. Welche Strategien sind da zielführend? Geht es nur um Werbung oder andere Lehrmethoden, um Kooperationen? Antworten auf diese Fragen erhoffe ich mir aus diesem Gespräch mit Andrea Lehner-Hartmann. Sie ist Dekanin der theologischen, der katholisch -theologischen Fakultät in Wien. Dann Professor Uta Heil. Sie ist Dekanin der evangelischen Fakultät in Wien, als Hausherrinnen quasi. Und dann mit dabei Gerd von Oyen, Präsident der oder Dekan der theologischen Fakultät. der Katholischen Uni von Louvain in Belgien und Rainer Hirsch-Louipold, Dekan der Theologischen Fakultät der Uni Bern. Herzlich willkommen in die Runde. Vielleicht zunächst mal Frau Professor Hartmann, Lina Hartmann, Frau Professor Heil als Hausherrinne zur Diagnose. Wie sieht es aus momentan in diesem Jahr oder heuer? Die Diagnose lautet ja, wenn ich es richtig verstehe, dass die Attraktivität des theologischen Studiums Luft nach oben beated.
Andrea Lehner-Hartmann: Ja, Luft nach oben drückt es denke ich ganz gut aus, aber wir haben gesehen, dass wir damit auch im europäischen Trend liegen, das heißt, wir haben alle im europäischen Raum ziemlich die gleichen Phänomene, das reicht von Rumänien bis nach Oslo, gibt es überall die große Frage, wie denn die Studierendenzahlen bei uns ausschauen und wie wir sie verbessern können.
Uta Heil: Ja, und insgesamt gesehen ist das ein Phänomen, was die Theologie -Studierenden, beide Fakultäten betrifft, also die beide Konfessionen betrifft, evangelisch und katholisch. Konkret haben wir jetzt an der Evangelischen Fakultät hier in Wien nicht so den massiven Einbruch. Aber wenn man jetzt schaut, auch den deutschsprachigen Raum insgesamt sieht, kann man diesen Trend schon sehen, dass es weniger Studierenden gibt und es ist offenbar weniger attraktiv. den Fachdienst anzustreben oder Religionslehrer in der Schule zu werden, Religionslehrerin in der Schule zu werden. Und insofern, weil das natürlich bei unseren konfessionellen theologischen Fakultäten die bevorzugte Klientel in der traditionellen Aufstellung der Fakultäten ist, schlägt sich das natürlich unmittelbar nieder in den Anfängerzahlen. einfach das sinkende Interesse, Pfarrerinnen und Pfarrer zu werden, Priester zu werden oder Religionslehrer zu werden. Daran kann man natürlich gleich auch anknüpfen, dass wir einfach unser Potential, das die Fakultäten bieten, anders anpreisen und anbieten müssen für andere Studierenden, andere Interessenlagen.
Moderation: Ich gebe das Mikrofon jetzt weiter an die beiden Gäste in der Runde. Wie haben Sie es denn bisher hier in Wien erlebt? Die Diagnose in Wien ist oft so, dass die Zahlen rückläufig sind oder in Österreich insgesamt, die Theologie -Studierenden zahlen. Und dann gibt es verschiedene Gründe dafür. Manche sagen, das ist die katholische Großwetterlage oder die kirchliche Großwetterlage, um es sozusagen, ja, also von Missbrauchsskandal und so. Man kann als Kirche derzeit nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen in der öffentlichen Wahrnehmung. Andere sagen, es ist ein Generationenproblem, auch andere Geisteswissenschaften haben zu kämpfen. Wie stellt sich das bei Ihnen jeweils da in Bern und in Belgien?
Gerd von Oyen: Wir haben hier gesehen, in diesem Kolloquium, in diesem Meeting, dass, wie schon gesagt, das ist von Oslo bis Bucharest, dass wir die gleichen Probleme haben, weil wir haben, jeder von uns hat einen eigenen Kontext, in welchem wir arbeiten, aber doch haben wir gemeinsame Probleme und wir denken doch, dass es verschiedene Level sind, wo man die Probleme situieren kann. Es gibt ein Problem mit der Theologie. Wir suchen, wie wir uns besser in den Markt setzen und sagen, was wir machen und wie wichtig wir sind in heutiger Gesellschaft, wenn wir alle Probleme und Kriege und Konflikte und ethische Probleme und Suchen nach Meinung und Sinn im Leben sehen. dann denken wir, dass wir etwas zu sagen haben als theologische Fakultät. Aber wie man das macht, das ist manchmal ein Problem, weil es gibt viele Probleme, wie Sie gesagt haben, in der Gesellschaft und in der Kirche. Aber ein anderes Problem ist doch diese Sekularisierung, die immer weitergeht. Und das ist auch ein Problem in allen Kontexten.
Moderation: Ist das eine Diagnose, die man auch in der Schweiz genauso stellen würde oder stellen sich in der Schweiz nochmal wieder andere?
Rainer Hirsch-Louipold: Ich glaube, ein Aspekt dieses Treffens der Dekane und Dekaninnen aus ganz Europa ist, dass wir sehen, wie unterschiedlich die Situation ist. Nachdem Gerd eben gesagt hat, dass wir alle die gleiche große Wetterlage sehen, dann ist es doch von Universität zu Universität, von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Insbesondere auch damit zusammen, wer überhaupt unsere Adressaten sind, also für welchen Bereich wir überhaupt Studierende ausbilden wollen. In Bern ist das relativ klar. Wir sind eine Fakultät, die setzt sich zusammen aus einer reformierten Flügel und einem christkatholischen, altkatholischen Flügel. Und unser Auftrag seitens des Kantons der Regierung ist vor allem zunächst einmal künftige Pfarrer. heranzuziehen. Das ist unser Auftrag. Das ist aber nicht, was die Gesellschaft notwendigerweise als attraktiv an Theologie empfindet. Also sind wir gefangen zwischen auf der einen Seite der Zielperspektive, welche Studierenden wir ausbilden sollen, und auf der anderen Seite der Frage, was sieht die Gesellschaft als relevant an. Ich glaube, das trifft uns nun wieder alle Fakultäten. Da müssen wir und einen Weg zwischendurch finden und das wird bei einer theologischen Fakultät wie unsere ganz anders aussehen, wie bei einer Fakultät für Religion und Kultur, Religionswissenschaft und Kultur, wie etwa in Roningen oder anderswo.
Moderation: Nachdem wir jetzt die Diagnose gehört haben, die relativ ähnlich ist, auch wenn es im Detail natürlich Unterschiede gibt, wie wir gerade schon gehört haben am Beispiel von der Schweiz, was ist denn jetzt dabei rausgekommen bei Ihren Beratungen, auf was hat man sich denn verständigen können als Heilmittel der Situation? Gibt es Best Practice Beispiele, wo man auch in Österreich sagt, ach ja, das könnten wir mal machen oder das ist ja ein interessanter Aspekt gewesen?
Andrea Lehner-Hartmann: Also ich denke, wir selber sind ja schon auch auf dem Weg und haben schon im Vorfeld überlegt, wie wir denn auch in der Zusammenarbeit die Studierendenzahlen in Zukunft gestalten können. Und da ist unser Weg jetzt, dass wir uns noch ein bisschen internationaler ausrichten wollen, auch mit einem neuen Master. Im Doktoratsprogramm haben wir das schon sehr lange, aber wir sehen natürlich auch, dass das auch für andere Fakultäten in Europa teilweise auch der Fall ist, Programme anzubieten. die nicht nur die Studierenden vor Ort attraktiv finden, sondern die auch noch Studierende aus anderen Ländern anlocken, was prinzipiell ja auch eine gute Sache ist, weil man hier auch viel kennenlernen kann. Und ich denke auch, dass die Studierenden vor Ort attraktiv finden, sondern die auch ...
Uta Heil: dass genau das der richtige Weg ist, dieser Master, den wir jetzt versuchen wollen, möglichst bald umzusetzen, Religion in Europe. Und der ist genau darauf ausgerichtet, einen Studierenden Klientel anzusprechen, die jetzt eben nicht das klassische Ziel, Pfarreramt oder Religionslehrer anzustreben. Und das erfordert natürlich aber auch bei uns einfach ein Perspektivwechsel. Wir haben halt einfach nicht mehr selbstverständlich die Kirche als – neu Englisch gesprochen – Push -Faktor, der eben die Studierenden in die Fakultäten führt, selbstverständlich. Und wenn das wegbricht, ist dann die Frage, welche anderen Push -Faktoren in der Gesellschaft kann es geben. Aber darauf zu warten, dass ... können wir eigentlich auch nicht zulassen, so müssen wir uns eigentlich eher neue Pull -Faktoren überlegen, was zieht Leute an die Fakultäten und da ist eben dieser Master eine Möglichkeit, der soll auch grundsätzlich auf Englisch angeboten werden und auch möglich sein und offen sein für Leute, die zum Beispiel schon ein Berufsleben stehen und deswegen soll er auch in einer flexiblen Form mit hybrigen Lehrformaten angeboten werden, so dass man auch nicht gezwungen ist, während des Studiums durchgängig in Wien anwesend zu sein, um da halt auch eine größere Flexibilität zu haben.
Moderation: Und dieser Master ist ein ökumenischer Master, also ein fakultätsübergreifend geplanter.
Uta Heil: Ja, das ist ein gemeinsamer Master, von uns beiden hauptsächlich getragen, aber es soll noch darüber hinausgehen, dass wir in anderen Fakultäten oder Instituten auch noch Lehre mit integrieren, von sozialgeschichtlichen, empirischen bis hin zu Rechtsgeschichte und anderen Fragen, Kunstgeschichte. Es gibt ja viele Bereiche in der Gesellschaft, wo Religion eine Rolle spielt. Und wir das am besten ja auch interdisziplinär erforschen, aber eben auch in diesem Master den Studierenden vermitteln wollen. Es gibt noch kein Curriculum, da ist noch ein bisschen To -Do für uns, aber wir haben eigentlich schon so viele Ideen dafür entwickelt und in dem Gespräch heute und gestern mit den Dekanen aus den anderen Fakultäten zeigt sich auch, dass das wahrscheinlich doch der richtige Weg ist und es gibt auch an anderen Fakultäten und Instituten ähnliche Versuche, Theologie neu zu denken.
Moderation: Aber das hieße ja potentiell mit dem Blick nach Belgien und in die Schweiz, dass das Konkurrenz ist oder? Dass ich sagen könnte, ah, das ist ein Master, der in Wien angeboten wird, der auch noch nicht mal Präsenz erfordert zwingend und auf Englisch ist, das muss Ihnen doch gar nicht unbedingt gefallen, oder?
Gerd von Oyen: Eine der Zielsetzungen von diesem Meeting ist, wie können wir zusammenarbeiten? Und wenn wir hören, was anderen machen, das kann uns inspirieren, auch etwas zu machen, aber auch zusammenzuarbeiten. Nicht in Konkurrenz, aber zusammen. Wie gesagt, wir haben alle die gleichen Probleme und wir suchen auch Lösungen, die verschieden sind, abhängig von der Situation von jeder Universität und Fakultät, Aber gleichzeitig auch ... uns zusammenbringen, weil die eine der Sachen, die ich hier gelehrt habe, ist, dass wir müssen suchen nach der Relevanz von der Theologie in der heutigen Gesellschaft. Ich denke, dass wir müssen sagen, dass Theologie ist über Gott, Theologie, aber Gott ist auch über Konflikt, Dialog, Krieg, Menschen zusammenarbeiten. Vielen Dank für's Zuhören. Bis zum nächsten Mal. und alle menschliche, anthropologische Aspekte. Wir machen etwas in Theologie, das Relevanz hat für die ganze Gesellschaft oder für jeden Individuum, jede Person. Und wenn wir sehen, dass in anderen Sitzungen in Europa kreative Lösungen bedacht werden, dann denke ich, dass es hier Möglichkeiten bietet, zusammenzuarbeiten. und eine der Issues, dass wir besprochen haben, ist die Sprache. In welcher Sprache sollen wir Unterricht geben? Und wir haben gesehen, dass es ist eine Tendenz, um unsere eigene Sprache zu behalten, niederländisch, französisch, rumänisch oder was auch. Aber zu gleicher Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, um international zu arbeiten, mit den neuen Kommunikationsmitteln, die es gibt. und auch wenn Wenn wir wirklich wünschen, zusammen zu arbeiten, dann ist es möglich, dass so.
Moderation: Ähnliche Einschätzung in der Schweiz oder ein bisschen Sorge vor dem Wiener Angebot?
Rainer Hirsch-Louipold: überhaupt keine Sorge. Also ich glaube, dass, wie gerade schon gesagt wurde, es geht für uns, glaube ich, als Fakultäten überall in Europa darum, als theologische Fakultäten zu erkennen, dass die Studierenden nicht mehr einfach zu uns kommen, sondern dass wir unsere Angebote klarer vermitteln müssen. Unsere Angebote an die Studierenden, aber auch an die Gesellschaft Insgesamt will ein. ein Beispiel nennen, das wir nicht im offiziellen Programm, aber gestern beim Abendessen intensiv diskutiert haben. Wir hatten am 7. Oktober dieses horrende Terrorakt in Israel, der uns alle, alle, die sich in irgendeiner Weise mit Religion beschäftigen, zutiefst erschüttert hat in dem Sinne, dass wir bestimmte Bereiche neu denken müssen. Das ist ein Bereich, wo wir sehen, wir müssen die Gesellschaft neu, wir müssen dazu helfen, als theologische Fakultäten die Gesellschaften neu sprachfähig zu machen in diesem Bereich. Wir stellen fest, international nicht nur in Europa, sondern natürlich insbesondere auch in Amerika, dass die Gesellschaft insgesamt keine Sprache mehr findet, um umzugehen mit dem Phänomen. Das ist so eine so eine Stelle wo wir glaube ich gar nicht so weit sind, dass wir irgendwelche Lösungen anbieten können, aber wo gerade so ein europäisches Gespräch unglaublich hilfreich ist, um zu sehen, welche Wege kann es denn geben? Und auch dieses Gespräch, das wir ja führen, über Theologie und Religionswissenschaften und Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften hinweg, wie können wir auf solche Themen Antworten geben?
Andrea Lehner-Hartmann: Ich würde gerne das nochmal aufgreifen von der Konkurrenz, weil ich denke, für mich ist das auch nicht als Konkurrenz gedacht, sondern gerade weil wir ihn auch interdisziplinär und international ausrichten, wäre es für mich ganz wichtig, dass eben die anderen Perspektiven hier auch noch einmal hereingenommen werden können. Das heißt, wenn es woanders ein gutes Angebot gibt, das wir auch mit übernehmen können, bedienen können, im Sinne nämlich der Studierenden. dass sie die europäischen Perspektiven auch gut vermittelt bekommen, dann denke ich, ist das eine gute Möglichkeit. Aber nachdem wir es dann planen sind, denke ich, ist es gut, jetzt schon auch die Fülle ausgestreckt zu haben und zu schauen, was tut sich in Europa und wo ließen sich denn auch Kooperationen auch über die Programme, die es auf EU -Ebene gibt, hier auch noch gut integrieren.
Moderation: Nun ist es ja so, dass das Pontifikat des jetzigen Papstes ein Zeichen dafür ist, dass sich der Fokus auf Europa verschoben hat. Also das Kirche mittlerweile, der Kirchliche, der Katholische, Fokus sich verschoben hat auf andere Regionen der Welt, Lateinamerika. Damit einhergehend gab es auch zuletzt immer wieder die Diagnose, dass auch in der Theologie sich eigentlich schon lange der Fokus von der klassischen europäischen Theologie, die vor 30, 40 Jahren noch ... das theologische Zentrum war, dass sich das woanders hin verschoben hat. Stellen Sie das auch fest, vielleicht im Austausch auch über den europäischen Tellerrand hinaus, dass Sie sagen, eigentlich müssten wir sogar noch weitergehen oder ist das gar kein ...
Rainer Hirsch-Louipold: gar nicht im Fokus von ihnen. Also mein Eindruck ist, dass zu der Zeit, als ich studiert habe vor 40 Jahren, da war Lateinamerika viel stärker im Fokus als heute. Auch Afrika, Asien, wir sind allenfalls in Ansätzen dabei, die Theologien von dort einzubeziehen. Also das ist meine eine ganz andere. Die waren schon mal... wesentlich weiter und wir, jedenfalls im protestantischen Bereich, aber ich glaube im katholischen eigentlich auch. Und wir sollten eigentlich das globale Gespräch viel mehr intensivieren. Wir haben gerade diskutiert, dass die Orientierung auf das Englische hin, zu der wir ja alle hingehen, glaube ich, eine eher eine Konzentration Richtung Nordamerika. impliziert und also auch von daher nicht ganz unproblematisch ist im Blick auf die angesprochene Frage.
Gerd von Oyen: Ja, aber andererseits haben wir die meisten Fakultäten, haben auch Studenten aus der ganzen Welt, aus Lateinamerika, aus Korea, aus Afrika, so es gibt auch Kontakte, aber das ist noch etwas anderes, als was Sie gefragt haben, ob die andere Kontinenten auch etwas zu sagen haben und uns etwas lernen können. Und da denke ich, dass wir weiter dann Europa oder aus Europa sehen müssen. und die andere Stimme hören und die sind wichtiger und wichtiger, weil wir auch weniger sind. Das ist eine Sache. Und eine zweite Sache ist, dass die Diskussion mit anderen Kontinenten, anderen Glaubensweisen ist schon präsent in Europa, weil wir mit Migration Problemen und so und mit Islam und anderen Religionen, die da sind, heute schon das Ebat in Europa haben. Die Dialog ist schon da.
Uta Heil: um die globale, weltweite Theologie irgendwie einzubinden, was ich unterstreichen würde, durch die Migration hier eh schon notwendig ist und dadurch automatisch passiert, ist aber natürlich auch, wenn man jetzt so auf die ganz praktischen Sachen, das versucht runterzubrechen, auch gar nicht so einfach. Also wenn wir denken an unsere Curricula, die einfach durch die Umstellung auf Bachelor und Master auch noch sehr eng strukturiert, manchmal recht eng inhaltlich definiert sind, die sind doch ein Korsett, was erst noch mal zu liberalisieren und aufzusprengen ist. Und das hätte auch mehrere Vorteile, weil uns eigentlich dieses Korsett auch unabhängig von dieser Frage der Globalisierung einengt. Und wir eigentlich ein freieres Studium haben müssten, um dann überhaupt solche neuen Fragen besser einbringen zu können. Und nicht nur in der Form, ja, jemand macht dann doch einfach mal ein Seminar über ein Thema, weil es ihn oder sie interessiert. Das ist aber natürlich dann auch auszuverhandeln, weil wenn man Neues reinbringt, Und ein Studium hat nur eine gewisse Länge. Auf Kosten von was? Was bringt man raus? Oder bringt man das durch eine höhere Liberalität rein, dass man gar nicht so viel festlegt und definiert? Es ist natürlich dann auch gar nicht so einfach, die globale Perspektive einzubringen, ohne wieder auf einer Art Metaebene uns in ein kolonialistisches Denken zu führen. Ja, Lateinamerika, das mache ich jetzt auch noch mit. Sondern wenn Das müsste ja eher dann durch Input von dort auch kommen. Aber das geht ja auch nicht so von heute auf morgen. Wie soll man das einrichten? Wenn ich jetzt auf das Fach schaue, was ich selber unterrichte, Kirchengeschichte, ist es natürlich schön. Wir fangen eigentlich natürlich im ersten Jahrhundert an und kommen im 20. Jahrhundert an in unseren klassischen Überblicksvorlesungen. Aber Meine Kollegen wären wenig begeistert, wenn ich sage, ich brauche jetzt noch eine Überlegsvorlesung, weil ich muss nochmal globale Kirchengeschichte lesen. Oder wenn ich das jetzt einbringen sollte, dann auf Kosten. Dann mache ich einfach Reformation etwas kürzer oder Mittelalter fällt weg. Also jetzt nur mal auf eine ganz praktische Frage runtergebrochen. Und außerdem ist es ja auch dann immer eine Frage der wissenschaftlichen Redlichkeit, wenn ich wirklich ostasiatisches Christentum hier behandeln möchte. brauche ich auch Personen mit den sprachlichen Kompetenzen, diese Texte von dort zu lesen, dass es nicht nur so oberflächlich sekundär präsentiert wird. Es ist gar nicht so einfach, dieses globale, das kann man gerne schnell unterschreiben, aber wenn es dann konkret werden soll, finde ich das auch gar nicht so einfach, das umzusetzen.
Moderation: Sie haben jetzt sehr stark gemacht, als Zukunftsperspektive Kooperationen, Internationalisierung, gesellschaftliche Relevanz aufzeigen. Wenn man schaut, welche Studienangebote funktionieren, sind es ja eigentlich genau die anderen, Also die, die katholisch profiliert auftreten nach außen und sagen, wir bieten die eigentlichen katholischen Angebote an, die damit hausieren gehen, dass sie sagen, sie legen eben nicht vielleicht Wert auf. internationalisierung oder sowas, sondern haben ein dezidiert katholisches profil. kann man sich bei denen auch was abschauen, wie die das anders machen?
Rainer Hirsch-Louipold: Ich kann vielleicht aus einer zunächst mal unverdächtigeren, reformierten Perspektive sagen, die wir in der Schweiz haben. Es gibt natürlich evangelikale Hochschulen, die ein bestimmtes Frömmigkeitsprofil haben und so weiter und die durchaus attraktiv auch für Kirchen in der Schweiz sind und also sich die Frage stellt, was eigentlich das Verhältnis von akademischer Theologie und veramtlichem wirken. spät. Also das ist die Diskussion, die wir führen. Und da ist es, so wie Sie es beschreiben, dass für viele Studierende attraktiver ist eine so eine evangelikale Hochschule, die weniger akademischen Anspruch hat und die eingebunden ist in liturgische Studien und Glaubensleben, sage ich mal.
Andrea Lehner-Hartmann: Also ich möchte jetzt weniger zu den anderen Stellungen nehmen, aber ich denke, wir müssen einfach sehen, dass wir in den theologischen Fakultäten einfach nicht mehr für geschlossene Kreise ausbilden, sondern wir bilden aus für Theologinnen und Theologen, die in dieser Gesellschaft auch agieren können. Und das ist auch, auch wenn sie in einer Pfarre sind, wenn sie Priester sind, sie müssen einfach mit der Welt umgehen können und sich nicht irgendwo zurückziehen, wo sie ihr eigenes Leben mit einer kleinen Gruppe leben können. Das kann seine Berechtigung haben, aber wir sind an einer staatlichen Universität und wir haben auch diese Ausrichtung zu verfolgen und dafür stehe ich dann.
Gerd von Oyen: Als Katholiker und Dekan von einer katholischen Fakultät kann ich nur beahmen, was hier gesagt ist. Eine richtige katholische Theologie ist eine Theologie, die offen steht für Dialog, die alle Fragen stellt und sucht nach Antworten. Das ist das Einige, was ich sagen kann. Und eine Theologie, die sich einschlüsst oder wie sagt man das, die geschlossen ist und nur seine eigene Identität in erster Platz setzt. Das ist nicht die richtige und kritische akademische Haltung von einer universitären theologischen Fakultät.
Moderation: Allerletzte Frage in die Runde, was nehmen Sie denn von Ihren Beratungen jetzt konkret mit hier? Gibt es Beschlüsse dergleichen? Also ich habe schon gehört jetzt oder rausgehört, in Wien arbeitet man an einem Curriculum für einen neuen Master. Gibt es da schon einen Zeitplan, wann das denn tatsächlich greifen soll, den man auch kommunizieren kann, wann die Bewerbungsmöglichkeiten starten und was nehmen die Gäste aus Belgien und der Schweiz mit?
Uta Heil: Also unser neuer Masterstudiengang wird kommen. Der steht jetzt in dem bald veröffentlichten Entwicklungsplan der Universität Wien drin, also schwarz auf weiß, und ist geplant für das Wintersemester 2025 mit Start. Und wir hoffen, dass das auch klappt und durch die ganzen Gremien bis dahin durchgeht. Und wir nehmen eigentlich jetzt von diesen Wir besprechen gestern und heute auch die Bestätigung mit. dieses umzusetzen und zu forcieren und haben vielleicht auch noch ein paar zusätzliche Detailaspekte, die wir da noch mit einbauen können. Das passt eigentlich jetzt ganz gut, weil wir uns erst noch dransetzen müssen, ein Curriculum zu entwickeln. Und deswegen diese Öffnung. Ich sprach von Push - und Pull -Faktoren. Wir müssen eigene Pull -Faktoren entwickeln, die Studierenden anreizt, hier an die Fakultät zu kommen. Und dieser Masterstudiengang wäre sicher ein Punkt dazu, weil wir einfach nicht mehr die Selbstverständlichkeit haben, die Zahlen sinken und die Interessenten fürs Fahramt sinken. Und deswegen reicht das dann einfach als Existenzberechtigung auf die längere Zeit gesehen einfach nicht mehr aus.
Andrea Lehner-Hartmann: Also neben dem, was wir für unsere Fakultät auch überlegen, nehme ich noch vieles mit an bestimmten Anregungen. Also mögen nur kleine Dinge sein, wie einen Karriere -Tag gemeinsam zu veranstalten von Alumni mit Studierenden. Oder dann, was ich auch noch mitnehme, ist eine besondere Aufmerksamkeit, welche Rolle letztendlich politische Entwicklungen haben. auf unsere Diskurse, beispielsweise in welcher Sprache unterrichtet werden soll an den Universitäten. Das heißt, wie da noch einmal eine bestimmte Identitätspolitik auch noch die Rolle spielt und ich denke, da hier auch aufmerksam zu sein, das nehme ich mir aus diesem Gespräch noch.
Gerd von Oyen: Was ich gelernt habe, ist, dass ich mit mit unserer Fakultät eine gute Analyse machen muss. Wie wie wer sind unsere Studenten und er heute und in der Zukunft und dass wir unser Curriculum auch abstimmen sollen auf wer wir als Publikum, als Studenten haben. Nur ein Beispiel. Ich wisse, dass in die Pyramide von Studenten anzahlen, die die die älter von 35 bis 55 Jahre die große Gruppe ist. Das bedeutet viel über wie man Unterricht gibt und was man unterrichtet.
Rainer Hirsch-Louipold: Ja, ich nehme mit, dass wir, wir haben uns darüber ausgetauscht, dass wir alle mit den Schwierigkeiten konfrontiert sind, den Bekannten, aber ich nehme ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten mit, wie wir besser vermitteln können, was wir für Angebote haben, in die Gesellschaft hinein, aber auch beginnend im Grunde mit der Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Und dass wir das umsetzen. müssen nun hingehen und erklären, warum man Theologie studieren soll und dass ich überzeugt bin, dass die Studierenden dann auch wieder kommen.
... dass die Studierenden dann auch wieder kommen werden. Das ist eine schöne Perspektive, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank in die Runde für das Gespräch und noch einen guten Abschluss der Tagung.