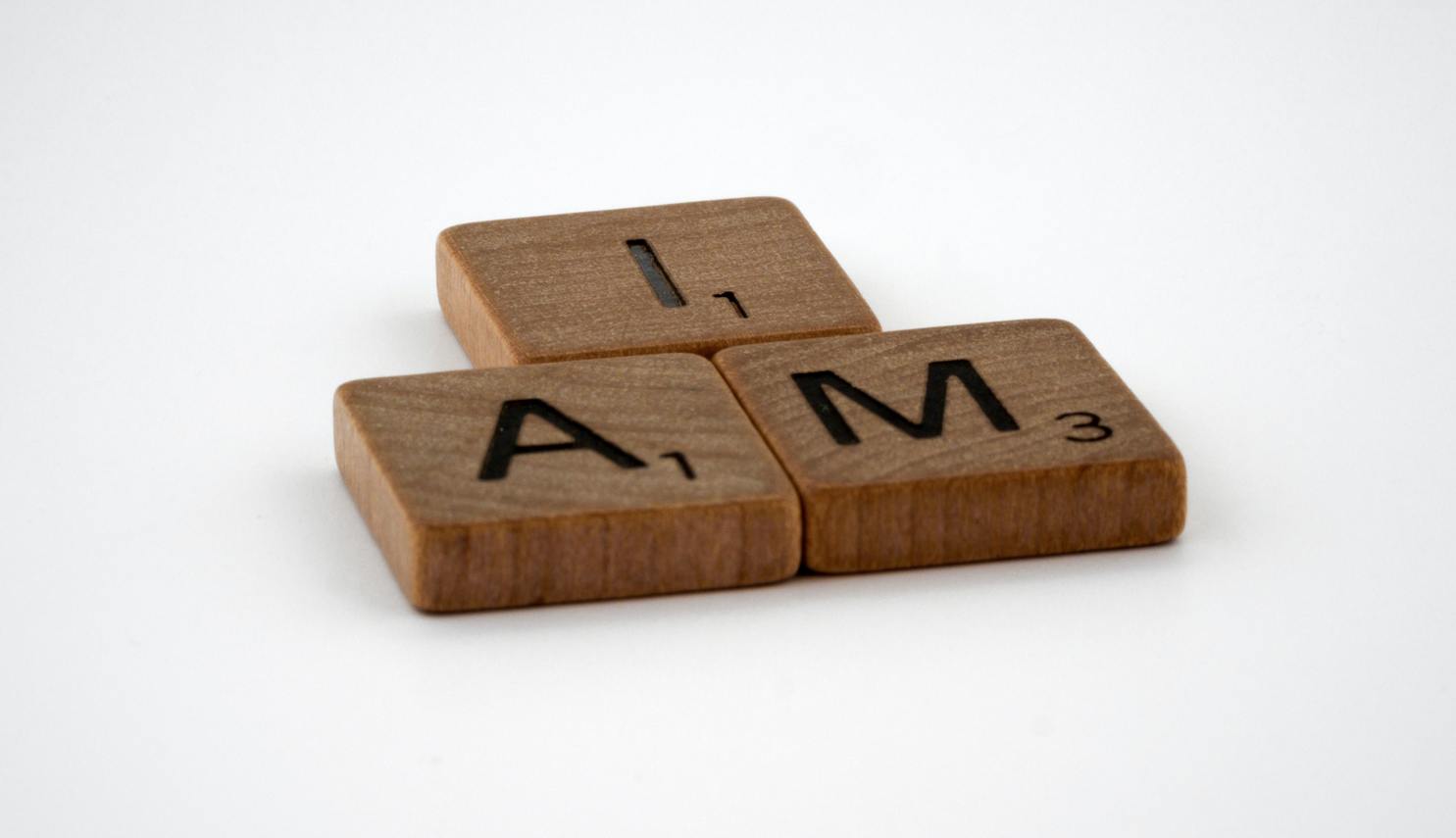Nach dem Tod von Papst Franziskus: Welche Zukunft hat das Papstamt?

Foto: Vatican Media
Podcast vom 26. April 2025 | Gestaltung: Henning Klingen*
Halleluja, wir sind Papst! - und zwar alle. Diesen Eindruck konnte man in den letzten Tagen rund um den Tod und die Beisetzung von Papst Franziskus gewinnen. Plötzlich war die katholische Kirche wieder in aller Munde. Nicht wegen eines Missbrauchsskandals oder anderer Krisen, nein, weil ein alter Mann an ihrer Spitze mit 88 Jahren gestorben ist.
Das ist doch nichts Besonderes, könnte man da denken. Menschen sterben nun mal - noch dazu, wenn sie schwer krank sind. Aber in dem Fall war es was Besonderes: Denn der Papst ist ja nicht irgendwer. Er ist das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Gläubigen. Und er hat von Beginn seines Pontifikats an Zeichen gesetzt: Er hat ungewöhnlich kommuniziert. Er hat Nähe zu Menschen gezeigt, einen bescheidenen Lebensstil gepflegt, seiner Sorge um Migranten, Kriege und um die Welt und die Schöpfung Ausdruck verliehen. Das alles hat ihm viel Lob und herzenswarme Nachrufe beschert.
Bei "Diesseits von Eden", dem Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich, wollen wir jetzt diese Zeit der Sedisvakanz - also die Zeit bis ein neuer Papst gewählt wurde, nutzen, um einmal über die Zukunftsfähigkeit dieses Amtes zu sprechen. Mein Name ist Henning Kling und ich begrüße zu unserer heutigen Folge drei ausgewiesene Experten:
Zum einen den Grazer Pastoraltheologen Professor Bernd Hillebrand. Er hat zuletzt in einem Nachruf auf Franziskus online auf der Website der Fakultät dessen neuen Stil gelobt, zugleich aber unterstrichen, dass die dogmatische Einholung, also die kirchenrechtlich-verbindliche Regelung, dieser Neuerungen noch aussteht.
Dann aus Münster hinzugeschaltet der Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf, der durch seine Arbeit in den vatikanischen Archiven und seine gleichsam archäologischen Bohrungen dort unter anderem zu Päpsten und ihren Amtsführungsarten bekannt wurde. Im Deutschlandfunk hat er zuletzt gesagt, es brauche künftig ein Papst, der sein Amt in dem Sinne katholisch versteht, dass es ein Amt der Einheit ist - und zwar eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit.
Und schließlich begrüße ich einen weiteren Kirchenhistoriker - aber mit einem anderen Forschungsschwerpunkt - den Salzburger Kirchenhistoriker, Ostkirchenexperten und Konsultor im Dikasterium zur Förderung der Einheiten der Christen, also ein Ökumene-Experte, Professor Dietmar Winkler. Er hat zuletzt zum Amtsverständnis von Franziskus gesagt, dass dieser einem frühkirchlichen Verständnis des Bischofsamtes gefolgt ist.
Reformpapst – im Sprung gehemmt
Um jetzt daran gleich anzuknüpfen, an Sie alle drei die Frage: Wie hat denn Franziskus Ihrer Ansicht nach das Papstamt ausgefüllt? Welche Akzente hat er gesetzt, anders als seine Vorgänger?
Hubert Wolf: Das erste und sicher bleibende wird sein die Namenswahl. Also zum ersten Mal in der Papstgeschichte traut sich ein Papst, sich Franziskus zu nennen. Das ist sehr ungewöhnlich. Und zwar deshalb, weil natürlich Franziskus, der heute immer als der große Heilige der katholischen Kirche gilt, der ist so ganz knapp dran vorbeigeschlittert, als Ketzer verbrannt zu werden, weil er diese reiche Papstkirche die Kirche seinerzeit massiv kritisiert hat und die Nachfolge des armen Jesus, der keinen Platz hat, wo er seinen Haupt legen kann, propagiert. Diesen Papstkritiker zum Namenspatron eines Papstes zu machen und den Machtapparat des Papstums, seine Machtfülle mit dem Franziskanischen zu verbinden, das ist eine ungeheure Spannung gewesen in diesem Pontifikat. Dann: Es ist seit ganz langer Zeit das erste Pontifikat, das mit einem zurückgetretenen Papst leben musste. Ein Papst, der von den Gegnern, also Benedikt XVI., einem emeritierten Papst etwas, was es vorher gar nicht gab. Das hat Benedikt erfunden. Und ganz häufig haben mir Menschen gesagt: Jetzt sind da zwei weiße Männer auf dem Petersplatz. Papst und Gegenpapst. Das war ein bisschen schwierig. Dann vielleicht zum dritten Punkt: Ich selber sehe das Pontifikat ziemlich deutlich in zwei Phasen: Die erste Phase: er ist gewählt als ein Reformpapst. Ich war damals in Rom - und wenn man die Debatten so anschaute - Vatikleaks und so - da musste einer von außen kommen und mal den Besen in die Hand nehmen. Man denke an Weihnachtsansprache, wo Franziskus sagte, ihr Kardinäle habt alle geistlichen Alzheimer. Ihr seid alle karrieresüchtig. Ihr seid ein Tratsch-Club. Auf die Weise nimmt man Mitarbeiter nicht wirklich gut mit... So war es bei Franziskus auch. Das heißt, dieses Fremdeln des Papstes mit der Kurie zieht sich durch. Dann kommen drei Enzykliken, die haben mir Hoffnung gemacht: "Evangelii Gaudium". Stichwort Subsidiarität: Alles soll dort entschieden werden, wo es entsteht, nämlich in den Ortskirchen. Und nur ganz wenig soll nach Rom. Super! Davon ist aber wenig umgesetzt. Lehramtlich vielleicht am wichtigsten: "Laudato si'": Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht - denn da geht ein Papst her und sagt: Die Offenbarung sagt nichts über Erderwärmung. Ich muss erst mal naturwissenschaftliche Experten fragen. Die Experten sagen mir, es liegt zu 95 Prozent am menschlichen Handeln. Dann sagt er: wenn es am Menschenhandeln liegt, dann können wir als Menschen, indem wir unser Verhalten ändern, etwas tun. Und dann ist die Norm, die sich daraus ergibt, nicht für Christen etwas Besonderes, sondern es gilt für alle Menschen guten Willens gleichermaßen. Wir haben aber einen zusätzlichen Sinnhorizont, eine zusätzliche Motivation, weil wir natürlich vom Schöpfungsglauben herkommen. Das fand ich ganz großartig. Wenn er das weitergeführt hätte - zum Beispiel in der Sexualmoral - und gesagt hätte Homosexualität ist eine Veranlagung und vielleicht keine Sünde, dann wären wir ganz woanders hingekommen. Für mich ist der Kipppunkt dann die Amazoniensynode gewesen. Ich war selber eingeladen, um mit brasilianischen Bischöfen und Kardinälen darüber zu reden und Quellen aus der Tradition der Geschichte zu lesen. Haben wir denn verheiratete Priester in unserer Tradition gehabt? Ist das, wenn wir das wieder möglich machen, ein Bruch mit der Tradition? Widerspricht das einem Gebot Jesu? Und diese konservativen Männer haben sich ganz schwer getan, sich aus der Tradition belehren zu lassen und zu sagen: Ja, verheiratete und zölibatäre Modelle gehören zusammen. Und dann stimmen die mit drei Vierteln auf der Synode dafür, dass man das möglich macht; Und der Papst geht mit großer Souveränität und Schweigen darüber hinweg. Das war für mich ein ganz entscheidender Kipppunkt, wo ich sage: OK, der kündigt viel an, am Ende zieht er aber nicht mal das durch, was er nach seiner eigenen Ordnung durchziehen müsste. Viel Ankündigung, aber wenig kirchenrechtlich umgesetzt. Und das ist ein ganz großes Problem: Wir haben nichts, was wirklich mal geklärt ist. Wer bin ich, dass ich homosexuelle Menschen verurteile? Okay, das war ein neuer Stil. Aber daraus kirchenrechtlich zu sagen, wir segnen homosexuelle Menschen ganz selbstverständlich, das hat er nicht gemacht. Vielleicht darf ich noch eine Schlussbemerkung machen: Ich bin ihm ja manchmal auch persönlich begegnet. Zuletzt im Kontext unseres großen Projekts mit diesen tausenden Bittschreiben jüdischer Menschen an Pius XII., die wir im Vatikanischen Archiv gefunden haben. Da haben wir ein 1940 geborenes Kind einer ledigen jüdischen Mutter, das überlebt hat aufgrund der Hilfe des Vatikans, in Tel Aviv gefunden. Und wir haben diesen Mann, gleich alt wie Franziskus, in eine Audienz bei Franziskus begleitet. Und wie Franziskuss mit diesem Mann umgegangen ist, war ganz großartig. Also der Seelsorger in Franziskus. Bei aller Kritik, die ich in ihm theologisch und politisch vielleicht habe: Das hat mich tief beeindruckt.

Prof. Hubert Wolf, Münster
Enorme Transformationsdichte und angestoßener Kulturwandel
Da waren jetzt schon ganz viele Aspekte drin, auch was die Lehre betrifft, die jetzt gar nicht direkt das Papstamt oder Verständnis oder die Amtstheologie betreffen, auf die wir aber sicher später nochmal zurückkommen werden. Wie haben Sie beiden anderen denn das Pontifikat empfunden?
Dietmar Winkler: Ich würde ganz gerne eine andere Perspektive einbringen, weil ich diese Klage über den Mangel kirchenrechtlicher Fixierung und dogmatischer Fixierung eigentlich hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum höre. Das hat natürlich seine Berechtigung und ich gebe Hubert Wolf ganz recht bei seiner Einschätzung der Amazonien-Synode. Aber das hat aus meiner Sicht grundsätzlich mit dem pastoralen Zugang zu tun. Dieses dreifache "Todos" zieht sich wirklich durch: Alle sollen einbezogen werden. Er wollte an die Grenzen der Gesellschaft und der Menschheit gehen. Und ich finde dennoch bei aller Kritik im Detail die Transformationsdichte, die das Pontifikat geleistet hat, eigentlich enorm. Und angesichts der Erfahrungen in der Ökumene, wo wir seit Jahren ein Konvergenzdokument nach dem anderen produzieren und es dennoch keine ernsthaften Rezeptionsprozesse gibt, denke ich mir, dass besser als alle Dokumenten vielleicht ein Kulturwandel im Umgang miteinander ist. Damit kommt dann eine neue Dynamik auf. Dass es dadurch manchmal etwas oszilliert hat, zum Beispiel bei den Homosexuellen, das finde ich eigentlich ganz gut, weil das wegführt von diesem "Ex-Kathedra-Thema". Der Papst tritt als Mensch in Erscheinung, der auch korrekturfähig ist. Bei ihm ging es, so glaube ich, mehr die Praxis als die theoretisch-theologische Grundierung. Diese können sich schließlich immer auch als Luftschloss erweisen - wenn ich etwa an die Theologie von Joseph Ratzinger denke und somit an eine Theologie, die sich schwer tat, auf den Boden zu kommen. Den Einsatz von Franziskus für die Umwelt, für die Armen und Verfolgten, die Kriegsgeplagten, die Förderung der Frauen in hohen Ämtern - das kann man bei aller möglichen Kritik im Detail nicht mehr zurücknehmen. Da ist ein Transformationsprozess und ein Kulturwandel angestoßen worden, hinter den man nicht mehr zurückkommt.

Prof. Dietmar Winkler, Salzburg
Bernd Hillebrand, wir haben jetzt schon häufiger das Stichwort Pastoral gehört. Worin unterschied sich der pastorale Stil des Franziskus denn tatsächlich von seinen Vorgängern?
Bernd Hillebrand: Ich habe meinen Nachruf überschrieben mit "Ein Papst der Menschlichkeit", weil er eine ganz starke seelsorgliche Seite hatte, die geprägt war von seiner persönlichen Migrationshintergrund. Er wusste, wovon er sprach, hat das selber erlebt. Es ist also ein sehr authentischer persönlicher Stil gewesen, durch den er deutlich gemacht hat, dass nicht mehr das Amt eine Autorität hat, sondern ein authentisches Leben der Botschaft Jesu entscheidend ist. Und das war, glaube ich, auf einmalige Weise bei Papst Franziskus erlebbar. Und er hat damit eine Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils vollzogen, weil er nach innen und nach außen versucht hatte, Gaudium et spes 1 - "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi" - zu leben. Nach außen, indem er diesen Schrei der Armen wahrgenommen hat - geöffnet hin zur Schöpfung. Und nach Innen hat er ein Stück weit Abschied genommen von diesem Herrscherverständnis: Er hat sie verneigt vor den Menschen und sie gebeten, für ihn zu beten, bevor er sie gesegnet hat. Das zeigt sein Amtsverständnis. Und das ist völlig anders als das von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Er hat eine Dogmatik der Barmherzigkeit deutlich werden lassen mit seiner Leidenschaft für die Menschen. Und das ist spürbar gewesen und hat seinen Ausdruck im synodalen Prinzip gefunden. Er hat nach dogmatischen Schlupflöchern gesucht, um Räume für Frauen in der Kirche zu öffnen. Er hat also Prozesse in Gang gesetzt, allerdings ohne sie lehramtlich zu verorten. Und das ist die Situation, in der wir stehen. Meines Erachtens sind jetzt drei Szenarien möglich: Erstens, es gibt jemanden, der an dem genau weiterdenkt und in diesem synodalen Verständnis und in dieser gnadentheologischen Barmherzigkeitstheologie weiterdenkt. Zweitens, es könnte auch sein, dass es eine Gegenposition gibt und die Kirche wieder herausgenommen wird aus ihrem Weltbezug und sie folglich immer mehr zur Sekte wird. Und die dritte Variante wäre die schlimmste: Wenn es jemand wird aus dem Rechtskatholizismus, der einen Schulterschluss übt mit all diesen rechtsautoritären Systemen, die wir gerade weltweit erleben. Insofern ist es vielleicht mehr denn je entscheidend für die Zukunft von Kirche, wer jetzt Papst wird.

Prof. Bernd Hillebrand, Graz
"Das, was wir heute als Papsttum sehen, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts"
Vielleicht können Sie nochmal vor allem aus kirchen- und theologiegeschichtlicher Sicht schildern, wie das Papstamt überhaupt jene Entfaltung gefunden hat, die wir heute sehen.
Hubert Wolf: Die meisten Menschen sind irgendwie überrascht, wenn man sagt, dass der Papst erst seit 150 Jahren unfehlbar ist. Die meisten sind überrascht, dass es erst seit 150 Jahren so etwas gibt wie ein ordentliches Lehramt der Päpste. Ordentliches Lehramt heißt ja, dass die Päpste mit dem Anspruch auftreten, nicht nur dogmatische Formulierungen, die in der feierlichen Form des Lehramtes erlassen werden, binden die Gläubigen, sondern auch alle Äußerungen des Papstes zum Beispiel auf der Ebene von Enzykliken. Und das muss man hier einfach mal klar machen: Das gab es vor 1870 nicht. Das heißt: Das, was wir heute als Papsttum sehen, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Wir haben in der Geschichte der Kirche ganz andere und vielfältigere Modelle. Natürlich haben wir bereits im Mittelalter mit Gregor VII., Innozenz III., Bonifaz VIII., Päpste, die versuchen, durch rechtliche Vollmacht den Papst zum absoluten Chef der Kirche zu machen. Und jetzt sind wir als Kirchenhistoriker in einem Dilemma: Wenn dogmatisch solche Nägel eingeschlagen werden wie 1870 und jetzt von Synodalität geredet wird, dann passt da was nicht zusammen. Für mich würde Synodalität bedeuten: Die Monarchie muss durch Kollegialität eingehegt werden. Denn die Balance zwischen Kollegialität, Kontrolle und Monarchie ist aus dem Lot geraten. Und jetzt frage ich mal die Kollegen, wie sie das einschätzen. Denn ich habe den Eindruck, dass Franziskus eben nicht diesem westlichen Verständnis von Synodalität folgt, sondern es ihm um so etwas wie "jesuitische Selbstaktivierung" geht. Das entspricht dem jeusitischen Verständnis: Wenn es ein Problem gibt, dann sagt der General, ihr müsst jetzt alle mal nachdenken. Ihr seid alle gefragt - und am Ende aber entscheidet der General allein oder er entscheidet halt nicht. Und ich habe den Eindruck, es könnte sein, dass wir, wenn wir das synodale Verständnis von Franziskus richtig verstehen wollen, in diese Richtung denken müssen. Das konnte man nämlich beim Synodalen Prozess beobachten: Da hat mir ein Bischof gesagt, wie wunderbar das war, weil er zum ersten Mal mit einer katholischen Frau diskutiert habe. Da muss ich sagen: das scheint eine wunderbare Erfolgsgeschichte gruppendynamischer Selbsterfahrung von Bischöfen zu sein - aber es wurden eben keine Entscheidungen getroffen. Das Einzige, was da wirklich entschieden wurde, ist, dass wir weiter über den Diakonat von Frauen sprechen dürfen. Das andere sind tatsächlich Ankündigungen. Und ich gebe dem Kollegen Hillebrand ganz recht: Da nichts festgelegt wurde, kommt es darauf an, wie der Nachfolger weitermacht und ob das Pendel wieder zurückschlägt, wie so oft in der Kirchengeschichte.
Damit ist das Tableau eröffnet - und es waren sowohl Dietmar Winkler als auch Bernd Hillebrand angesprochen …
Bernd Hillebrand: Ich glaube, dass der Synodalitätsbegriff auch innerhalb der Bischofskonferenzen nicht klar ist. Ich bin jetzt seit drei Jahren in Österreich und merke ja schon hier, dass der Kommunikationsstil ein ganz anderer als in Deutschland ist und wo Entscheidungen im Kaffeehaus getroffen werden. Dabei bewegen wir uns in einem Sprachraum! Auch bei der päpstlichen Kommunikation muss man genau hinhören - sie ist südamerikanisch und jesuitisch geprägt. Und so sind auch die Synoden gelaufen - wie bei einer Flasche: Da konnte man im Flaschenbauch alles diskutieren - aber bei den Entscheidungen, im Flaschenhals, ist das alles nicht mehr entscheidend gewesen. Also da ist Franziskus gewissermaßen im Sprung gehemmt geblieben. Ich hatte schon den Eindruck, dass er gern mehr an Verantwortung in die regionalen Zuständigkeiten abgegeben hätte. Davon zeugt ja auch, dass es kein nachsynodales Schreiben mehr gab. Also er schien das vorzuhaben, den Teilkirchen mehr Kompetenzen zu geben. Aber es wurde nicht umgesetzt.
"Durch das 19. Jh. sind wir in Synodalität aus der Übung gekommen"
Dietmar Winkler, wenn wir über Synodalität sprechen, müssen wir auch über die Ostkirchen und die orthodoxen Kirchen sprechen, die ja Synodalität kennen...
Dietmar Winkler: Nach 40 Jahren Ostkirchenforschung weiß ich, dass dort auch nicht alles funktioniert und dass wir nicht alles als Vorbild von dort hernehmen können. Ich möchte aber zunächst zu dem, was Hubert Wolf und Bernd Hillebrand gesagt haben, noch etwas ergänzen: wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass die meisten Bischöfe, die heute ernannt sind, eben dieses 19. Jahrhundert-Bild vom Papst und von der Kirche nach wie vor im Kopf haben. Das heißt, der Papst ist eigentlich derjenige, der ganz oben steht, wie im 19. Jahrhundert das Verständnis ist. Und wir bekommen tatsächlich dieses Dogma von 1870 ganz schwer weg. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diesbezüglich schon Pflöcke gesetzt. Und ich sehe, dass Franziskus da angeknüpft hat und dass weitere Rezeptionsprozesse laufen. Was z.B. damals bei seinem ersten Auftritt auf der Loggia am Petersplatz kaum bemerkt wurde: Franziskus hat da schon an ein frühkirchliches Verständnis des Amtes angeknüpft! Er hat nämlich damals schon gesagt, dass Bischof und Volk den Weg der Kirche gemeinsam gehen mögen. Er charakterisierte die Kirche von Rom als jene, die den Vorsitz in der Liebe führt. Und dieses Zitat ist von Ignatius von Antiochien, also des ersten Kirchenvaters, wenn man so will, nach den kanonischen Evangelien. Da haben wir plötzlich ein ganz anderes Kirchenbild: Wir haben in den ersten 500 Jahren keinen Primus inter pares. Wir haben keinen Superpatriarchen oder was auch immer, sondern wir haben ein ganz anderes Verständnis der Partnerschaft der Bischöfe untereinander, ein ganz anderes Bild der Communio und der Synodalität. Und durch das 19. Jahrhundert sind wir total in der Synodalität aus der Übung gekommen. Die Synodalität muss also weiter geübt werden, aber wir können nicht wissen, welche Dynamik damit ausgelöst wird. Die Frage, die ich aber gern an Hillebrand und Wolf zurückgeben möchte, lautet: was wäre denn zu dogmatisieren gewesen, damit es eben nicht nur ein Kulturwandel ist, sondern verbindlich festgeschrieben bleibt?
Hubert Wolf: Ich würde sagen, in dem Moment, in dem bestimmte Dinge ausdiskutiert sind, muss ein Papst in der Machtfülle, mit der er ausgestattet ist, auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Wenn wir etwa mal den Weg weitergehen würden, den Franziskus mit "Laudato si'" eingeschlagen hat, nämlich die Naturwissenschaften zu fragen, dann wären wir in der Sexualmoral wo ganz anders. Dann lerne ich etwa von den Medizinern und den Naturwissenschaftern, Homosexualität ist keine Sünde. Dann wäre es doch auch an der Zeit, in einem lehramtlichen Dokument zu sagen: Der liebe Gott hat Menschen unterschiedlich gemacht - und daraus folgt pastoral das und das. Genau deshalb kritisiere ich die Amazonien-Synode so: Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass wir gleichzeitig und legitimerweise verschiedene Modelle der Verwirklichung des Katholischen in der Geschichte gehabt haben, ohne dass es die Einheit der Kirche stört. Warum kann man dann nicht in Amazonien oder in Deutschland oder in Österreich sagen: Wir haben verheiratete Priester und geweihte Frauen als Diakone, denn die gab es selbstverständlich in unserer Tradition! Wir haben sie schließlich für die Taufe gebraucht - oder sollte etwa ein Mann eine erwachsene Frau ausziehen, anfassen und bei der Erwachsenentaufe dreimal untertauchen? Das ging mit unserer Sexualmoral doch gar nicht! Aus dieser Tatsache folgt für mich, dass ein Papst diese Entscheidungen auch fällen muss. Ich will aber noch einen anderen Punkt sagen und da möchte ich auch die Kollegen nochmal fragen: Wie sehen Sie denn diese Rolle, dieses in Anführungszeichen "Gegenpapstes" Benedikt XVI.? War Benedikt ein Hemmschuh für Franziskus?
Dietmar Winkler: Meines Erachtens geht das künftig so nicht. Man muss eine Regelung finden, wie man mit einem "Papst emeritus" umgeht. Aus meiner Sicht hätte Joseph Ratzinger wieder in das Kardinalsamt zurückkehren und sich auch so kleiden müssen. Das hätte wesentlich das Amt von Franziskus unterstützt. So wurde der "Papst emeritus" gewissermaßen instrumentalisiert und wurde eindeutig zu einer Schwierigkeit für Franziskus. Problematisch war meines Erachtens auch, dass Benedikt XVI. im Jahr 2005 den Titel "Patriarch des Abendlandes" unter den Tisch fallen ließ. Besser wäre es gewesen, den Titel "Vicarius Christi" unter den Tisch fallen zu lassen, weil das ein missverständlicher Begriff ist. Nach dem Tod von Benedikt XVI. hat Papst Franziskus den Titel wieder eingeführt. Er wollte Benedikt also nicht brüskieren und hat gewartet, bis dieser gestorben ist. Und er wollte damit an die Tradition des Vorsitzes in der Liebe anknüpfen, des primus inter pares.
Bernd Hillebrand: Ich glaube nicht, dass der Weg von Franziskus ohne einen präsenten "Papst emeritus" ein gravierend anderer gewesen wäre. Er hat einfach Beeindruckendes auf die Beine gestellt in diesen zwölf Jahren und das Papstamt zu einem Amt des Dienens und des Machtverzichts entwickelt. Aber in der Kirche selber ist durch die Präsenz Benedikts XVI. etwas passiert: Da gab es plötzlich Kardinäle, die Zweifel an Entscheidungen des Papstes anmeldeten, die "Dubia-Kardinäle". Das hätte es unter Benedikt XVI. nicht gegeben! Und das hat bis heute eine Polarisierung in der Kirche vorangetrieben, deren Überwindung Aufgabe des nächsten Papstes sein wird.
"Eine ganz gewaltige Überforderung für einen Menschen"
1995 hat Johannes Paul II. In der Enzyklika "Ut Unum Sint" eingeladen, über die Ausübung des Papstamtes neu nachzudenken. Dieser Prozess trug im letzten Jahr auf einmal tatsächlich Früchte - denn es ist ein Dokument erschienen - "Der Bischof von Rom" -, in dem es darum geht, Korrekturen am Verständnis des Papstamtes vorzunehmen: etwa eine Korrektur der Lesart des Ersten Vatikanischen Konzils im Blick auf das monarchische Verständnis, dann die Verantwortungsbereiche des Papstes, eine Neufassung des Patriarchentitel "Patriarch des Westens" und seine Rolle für die Kirchen des Ostens etc. Das sind ja alles Akzente, die jetzt in diesem sogenannten "Studiendokument" skizziert wurden, deren lehramtliche Ausformung aber weiterhin aussteht. Was glauben Sie denn, wohin die Reise weitergeht?
Dietmar Winkler: Zunächst kurz zum Zustandekommen des Dokuments: Man hat alle Dialoge - nicht nur die mit den Ostkirchen -, die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gelaufen sind, auf diese Fragen durchgeforstet und einmal geschaut, was alles herauszuarbeiten ist. Das war eine mühselige Arbeit, das zu systematisieren und in eine Zusammenschau zu bringen. In der letzten Phase sind auch aus anderen Kirchen Theologen eingeladen gewesen, auf den Dokumententwurf noch einmal zu reagieren. Das ist dann noch einmal berücksichtigt und mit hineingedacht worden, bevor es publiziert worden ist. Eigentlich ist es daher nicht nur ein Dokument, das aus dem Dikasterium kommt, sondern ein Produkt der Dialoge, das noch einmal mit den Dialogpartnern durchdiskutiert worden ist. Jetzt muss es in den Rezeptionsprozess - denn ohne solche Prozesse existiert das Dokument faktisch nicht. Das heißt, alles, was auf den Tisch kommt, muss rezipiert werden, muss diskutiert werden und muss umgearbeitet werden. Und daraus sollten sich jetzt neue Perspektiven ergeben. Wir sind auf diesem Weg gerade erst am Anfang - aber es ist wichtig, denn nur so kann daraus etwas werden. Ansonsten wird das wieder nur eines von vielen Dokumenten für die Schublade.
Hubert Wolf: Ich bin dankbar, dass Herr Winkler die Entstehung und den Kontext dieses Dokuments noch mal klargemacht hat. Ich unterstreiche das Thema Rezeption, aber Rezeptionen nicht nur bei den anderen Christen, sondern vor allem Rezeption in Rom und Rezeption beim Papst! - Ich möchte noch auf etwas anderes hinaus: Das Papstamt hat heute nach wie vor eine ungeheure Faszination - und zwar weit über unsere Kirche hinaus. Und ich bin bei aller Kritik erst mal dankbar, dass wir mit dem Papstamt einen Einheitsspunkt haben. Jetzt bräuchten wir aber einen "katholischeren Papst" in dem Sinne, dass er Katholizität als Ausdruck von Breite und Vielfalt zulässt. Da hat Franziskus erste Punkte gesetzt. Ich möchte bei der Amtsfrage noch einmal etwas anders ansetzen mit Max Weber. Der unterscheidet drei Konzepte von Herrschaft: Zum einen die traditionale Herrschaft. Das ist jene, die vom Amt ausgeht. Die Person ist eigentlich irrelevant, dem Amt kommt Macht zu. Der Papst ist der Nachfolger des Petrus und Vicarius Christi - damit hat er Macht. Dann zum anderen die funktionale Herrschaft: der Papst muss Aufgaben wahrnehmen, er hat eine Funktion, die Macht erfordert. Und dann gibt es eine dritte, und das ist eigentlich die gefährlichste, die nennt Weber die Charismatische Herrschaft. Das bedeutet nicht, dass der Mensch an der Spitze Charisma haben muss, sondern dass er eine Projektionsfläche unserer Erwartungen ist. Das ist einerseits wunderbar und andererseits sehr gefährlich. Denn wir alle projizieren ja auch unsere Erwartungen auf das Amt und einen Nachfolger. Daraus folgt: eigentlich ist dieses seit 1870 total aufgepumpte, überladene Papsttum eine ganz gewaltige Überforderung für einen Menschen. Und daraus stellt sich für mich die Frage, ob wir so einen Einheitspunkt wie dieses Amt im jetzigen Zuschnitt wirklich brauchen, oder wäre doch besser Ambiguität mit allem Möglichen ohne so ein Amt? Ich wäre skeptisch, aber ich frage den Pastoraltheologen …
... dem jetzt das Schlusswort obliegt.
Bernd Hillebrand: Also ich schließe zunächst eigentlich an die pastoral-dogmatische Frage an, was das Amt eigentlich ist und wie das Amt überfordert. Und da glaube ich, dass es zunächst eine Diskussion über das Gottesbild braucht: Solange ich in Persona Christi agiere als Papst und mich so verstehe, werden wir nicht wegkommen von diesem Papstverständnis des 19. Jahrhunderts. Und insofern glaube ich, braucht es ein Ende der Sakralisierung des Amtes hin zu einem Presbyteramt. Das Presbytheramt hat die Aufgabe einer Sorge, und das brauchen wir mehr denn je nach außen und nach innen. Ein Vicarius Christi nur insofern, als er ein Vicarius Amoris ist. Also ein Vertreter, der immer wieder an diese selbstlose Liebe erinnert, in die Welte hinein und nach innen. Aber wir brauchen das Amt auch, weil es in dieser Pluralität des Katholischen eben auch toxische Strömungen gibt. Und mehr denn je, würde ich sagen, angesichts von Pentecostalismus, von charismatischen Bewegungen, von Rechtskatholizismus, braucht es ein Amt, das gerade erinnert, dass das Evangelium ein Beziehungsnetz bildet. Und insofern braucht es einen Papst, der eine hohe Ambiguitätstoleranz hat.
Wir leben zweifellos in einer spannenden Zeit. Wohin die Reise geht, wird man noch nicht sagen können. Was man aber sagen kann: es wird wieder einen Papst geben. Es wird ein Mann sein; und er wird die Menschen bewegen. Also es wird weiterhin spannend bleiben und tatsächlich große Aufmerksamkeit in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten wieder da sein für das Amt des Papstes und wie er agiert. Vielen Dank, mein Gesprächspartner in die Runde. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie auch Interesse haben, andere Podcast-Folgen von Diesseits von Eden zu hören: Uns gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und im Netz unter diesseits.theopodcast.at.
Vielen Dank fürs Zuhören sagt Henning Klingen.