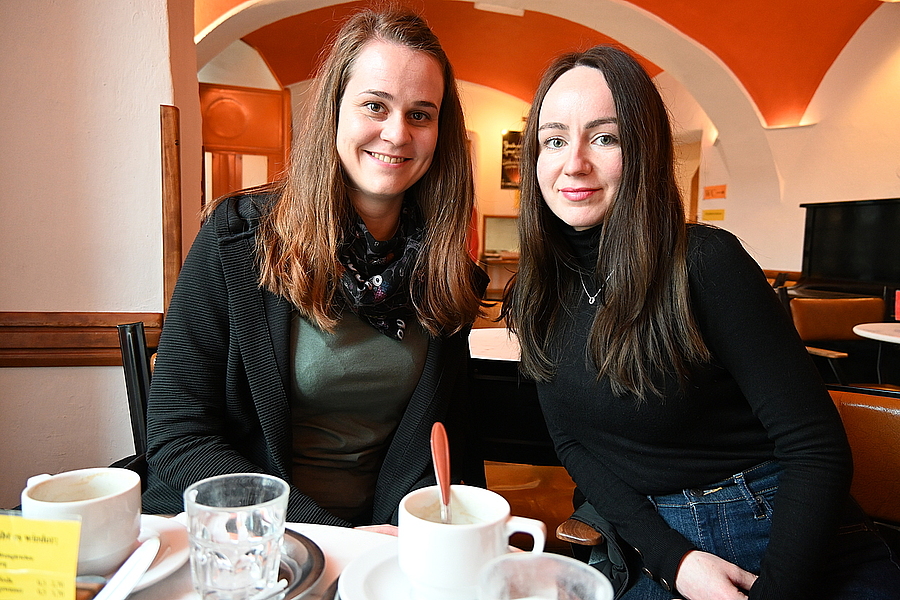Monarchen und Päpste: Welchen Einfluss hatten die Habsburger auf das Papsttum?
 Foto: Uni Wien
Foto: Uni Wien
Podcast vom 7. Mai 2025 | Gestaltung: Franziska Libisch-Lehner
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von „Diesseits von Eden“, dem theologischen Podcast mit Blick auf Geschichte, Gegenwart und Gesellschaft. Heute reisen wir in der Zeit zurück – in die Ära der Habsburger, und das aus gegebenem Anlass: Die Papstwahl steht an. Ich spreche heute mit dem Wiener Kirchenhistoriker Rupert Klieber von der Universität Wien über die Habsburger und die Frage, welche Rolle Kaiser und Könige bei der Suche nach dem – unter Anführungszeichen – „richtigen“ Papst gespielt haben. Und wie sie dabei Diplomatie, Netzwerke oder sogar ein Vetorecht für ihre Sache genutzt haben.
Herr Prof. Klieber, wie präsent war das Thema Papstwahl im politischen Denken der Habsburger? War das wirklich Chefsache der jeweiligen Kaiserin oder des Kaisers? Oder eher ein Thema für die Diplomatie im Hintergrund, über das gar nicht so viel geredet wurde?
Klieber: Wahlen waren natürlich immer beides: Chefsache und eine hochdiplomatische Angelegenheit. Der Kirchenstaat oder der Heilige Stuhl – wenn man es von der kirchlichen Seite her betrachtet – spielte ja über Jahrhunderte eine herausragende Rolle im Konzert der europäischen Mächte. Insofern war es immer eine hochpolitische Angelegenheit, einen Nachfolger zu kreieren und auch Einfluss darauf zu nehmen.
Wie genau sah dieser Einfluss aus? Waren das Briefe, Diplomaten, Reisen der Kaiserinnen und Kaiser selbst nach Rom? Wie wurde da konkret versucht, Einfluss zu nehmen?
Klieber: Die Beziehungen waren vielfältig und auf mehreren Ebenen. Es gab reguläre Botschafter der Mächte am Heiligen Stuhl. Ab dem 16. und 17. Jahrhundert gab es zunehmend auch päpstliche Botschafter an Fürstenhöfen – das war eine sehr hohe diplomatische Ebene. Aber auch andere Ebenen waren wichtig: Etwa Kardinalsernennungen in den eigenen Ländern. Wer Kardinal werden konnte – auch etwa für das Habsburgerreich oder für Spanien oder Frankreich – war eine hochpolitische Angelegenheit. Die Monarchen haben hier mitgemischt. Dann gab es auch sogenannte Kronkardinäle – also Kardinäle, die im Kardinalskollegium die Interessen einer bestimmten europäischen Macht vertreten haben. Und über die verschiedenen Kongregationen gab es ein weites Geflecht von Beziehungen und Einflussmöglichkeiten. Die Reisen von Monarchen nach Rom waren eher die Ausnahme – schon aus praktischen Gründen. Es war beschwerlich, nach Rom zu reisen. Umgekehrt reisten Päpste auch kaum – mit der berühmten Ausnahme im 18. Jahrhundert: Pius VI. ist über die Alpen gereist, auch nach Wien. Das war dem Umstand geschuldet, dass er retten wollte, was noch zu retten war – denn Josef II. war dabei, die Kirchenlandschaft seines Reiches komplett umzugestalten.
Können Sie eine konkrete Papstwahl in der Geschichte der Habsburger nennen, bei der sie entscheidend mitgemischt haben?
Klieber: Vorweg: Es gibt eigentlich keine Papstwahl, bei der sie nicht mitgemischt hätten – allerdings in unterschiedlichem Maß. Ein herausragendes Instrument, ab dem 17. Jahrhundert, war das sogenannte Exklusive. Drei Großmächte Europas haben sich das Recht herausgenommen – oder es wurde ihnen informell zugestanden –, ein Veto einzulegen, also einen Kandidaten auszuschließen, der ihren Interessen widersprochen hätte. Von diesem Vetorecht hat man immer wieder Gebrauch gemacht. Es war ein Präventiv-Veto gegen Kandidaten, von denen man befürchtete, dass sie den eigenen Interessen schaden würden – politisch motiviert, besonders in spannungsgeladenen Zeiten, etwa wenn Europas Mächte miteinander im Krieg lagen. Die Päpste waren politisch eine mittlere Macht – der Kirchenstaat umfasste ganz Mittelitalien, vom Raum Bologna bis vor die Tore Neapels. Das war ein nicht unbedeutender Faktor im europäischen Mächtekonzert. Und die Päpste waren so etwas wie – wenn man einen modernen Vergleich bemühen will – Kommissionspräsidenten eines vereinten katholischen Europas. Es war den Mächten also nicht egal, wer dieses Amt bekleidete – genauso wenig, wie es heute den Staaten Europas egal ist, wer Kommissionspräsidentin oder -präsident wird.
Können Sie ein konkretes historisches Beispiel nennen, bei dem besonders stark mitgemischt wurde?
Klieber: Die Literatur ist sich nicht ganz einig, wie viele solcher Fälle es gab, aber es waren mindestens ein Dutzend, in denen das Exklusive – also das Veto – eingebracht wurde. Im 17. und 18. Jahrhundert waren es vor allem Spanien und Frankreich, die davon Gebrauch machten. Von habsburgischer Seite ist der erste bedeutende Fall im 18. Jahrhundert zu finden – und zwar nicht nur als „Hausmacht“, sondern als römisch-deutscher Kaiser: Karl VI., der Vater Maria Theresias, hat gleich zweimal – 1721 und 1723 – ein Veto gegen denselben Kandidaten eingelegt: Kardinal Paulucci. Der erschien ihm viel zu frankreichfreundlich. Das war eine heikle Zeit – nach dem spanischen Erbfolgekrieg. Die Habsburger und die Bourbonen rangen um die europäische Vorherrschaft. Es drohte, dass eine dieser Mächte die Oberhand gewinnt – deshalb war es besonders wichtig, wer Papst wird. Karl VI. befürchtete, Paulucci würde französische Interessen vertreten, und hat ihn mit dem Veto zweimal verhindert. Er hätte sonst wohl gute Chancen gehabt, gewählt zu werden.
Der Kaiser war ja auch so etwas wie der Verteidiger des Glaubens. Sie atmen da gerade tief durch, wenn ich das so sage. Aber inwieweit hat diese Rolle eine Machtposition begründet oder den Anspruch bestärkt: Ich kann da mitmischen – ich muss da mitmischen?
Klieber: Nun, die Vorstellung, im Sinne des „wahren Glaubens“ Einfluss nehmen zu müssen, ist in der Neuzeit deutlich zurückgetreten. Einerseits, weil die Päpste selbst eine viel stärker kirchlich geprägte Rolle eingenommen haben, und andererseits, weil durch die Reformation das Thema Rechtgläubigkeit eine andere Dimension bekam. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 waren die konfessionellen Grenzen abgesteckt – das Thema war gewissermaßen erledigt. Politische Aspekte rückten in der Folge stärker in den Vordergrund. Natürlich spielte die persönliche Frömmigkeit der Monarchen weiterhin eine Rolle. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Umgang mit den Orden zur Zeit der Aufklärung. Die Bourbonenhöfe – Portugal, dann Spanien, Süditalien und schließlich Frankreich – begannen, massiv in die Ordenslandschaft einzugreifen. Zuerst traf es die Jesuiten, den Paradeorden der katholischen Reform. Man unterstellte ihnen, überall politisch mitzumischen. Die Ausschaltung eines so zentralen Ordens war eine hochpolitische Angelegenheit. Die persönliche Einstellung der Monarchen spielte dabei durchaus eine Rolle: Während die Bourbonenhöfe massiv auf ein Verbot drängten und später sogar das Konklave beeinflussten, damit ein Papst gewählt wird, der mitspielt, war Maria Theresia deutlich zurückhaltender. Ihre Frömmigkeit führte zu einer grundsätzlich positiven Einstellung gegenüber den Jesuiten. Sie hat sich der Entwicklung erst angeschlossen, als auf kirchlicher Ebene die Entscheidung gegen die Jesuiten gefallen war.
Die Habsburger treten aus heutiger Sicht – also aus dem Jahr 2025 – immer als besonders fromm auf. Im Kunsthistorischen Museum sieht man kaum ein Bildnis ohne Kreuz, ohne Bibel oder Gebetsbuch in der Hand der Monarchinnen und Monarchen. Das wirkt sehr demonstrativ – da muss es ein Zusammenspiel von Macht und Frömmigkeit gegeben haben.
Klieber: Die Monarchen alten Stils verstanden sich tatsächlich als „von Gottes Gnaden“. Sie sahen sich religiös auserwählt – eine Sichtweise, die sich auch in der Kunst über Jahrhunderte niederschlug. Doch diese religiöse Rolle des Monarchen wurde spätestens in der Aufklärung zunehmend in Frage gestellt.
Gerade am Übergang von Maria Theresia zu Josef II. zeigt sich ein Quantensprung im religiösen Selbstverständnis. Josef II. war durchaus religiös, aber er definierte seine Frömmigkeit anders: rationaler, aufgeklärter. Er unterwarf die religiöse Sphäre zunehmend vernünftigen Maßstäben und setzte Reformen um, wo er Missstände sah. Die katholische Aufklärung war ein großes innerkirchliches Ringen im 18. Jahrhundert – um Spiritualität, Kirchenbild, Theologie, Frömmigkeitsformen. Auch aufgeklärte Erzbischöfe griffen massiv ein, etwa in Salzburg Erzbischof Colloredo: Er hob Bruderschaften zugunsten von Schulfonds auf, reduzierte Feiertage, unterband Wallfahrten ins Ausland – Maßnahmen, die tief ins katholische und volksreligiöse Leben einschnitten und vielfach unpopulär waren.
Diese „Reform von oben“ hat sich bis ins Zweite Vatikanische Konzil durchgezogen. Josef II. etwa ließ nützliche Orden weiterbestehen und brachte die Besitztümer aufgehobener Klöster in einen Religionsfonds ein – aus dem dann ein flächendeckendes Pfarrnetz finanziert wurde.
Wir stehen nun mitten in einem Konklave, ein neuer Papst wird gesucht. Viele Hörerinnen und Hörer haben dabei vermutlich Bilder aus Serien, Filmen oder Medien im Kopf – visuelle Vorstellungen vom Vatikan. Wie beurteilen Sie als Historiker die aktuelle Situation? Gibt es Brücken zur Vergangenheit oder ist 2025 eine völlig andere Welt?
Klieber: Kirche, Politik und Kultur haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Es wäre kaum vorstellbar, mit den Maßstäben des 18. oder 19. Jahrhunderts an heutige Prozesse heranzugehen. Was erstaunlich gleich geblieben ist, sind die rituellen Formen der Papstwahl. Sie sind historisch aus praktischen Notwendigkeiten entstanden – etwa um langwierige Entscheidungsprozesse zu vermeiden. Zwei-Drittel-Mehrheiten in disparaten Gruppen sind bekanntlich schwer zu erreichen. Das Konklave mit seinem strengen Reglement war ein Versuch, solche Blockaden zu überwinden. Früher dauerten Konklaven mitunter zwei Jahre – weil sich zwei Lager unversöhnlich gegenüberstanden. Die Isolation im Konklave sollte helfen, „dem Heiligen Geist mehr Spielraum“ zu geben. Seit rund 150 Jahren verlaufen die Wahlen schneller. Ein Wendepunkt war 1870: Der Kirchenstaat ging im Zuge der italienischen Einigung unter. Der Papst verlor seine weltliche Macht und schien in der Luft zu hängen. Pius IX., 1846 gewählt, war der letzte Papst mit monarchischem Gepränge. Nach ihm kam Leo XIII. – der erste „Papst ohne Land“. Und erstaunlicherweise gewann das Papsttum an Einfluss: Die emotionale Bindung an den Papst stieg. Bilder, Wallfahrten, Jubiläen – das Papsttum wurde zu einem modernen Symbol mit großer moralischer Autorität.
Das Veto 1903 war also so etwas wie das letzte Aufbäumen der Habsburger?
Klieber: Ja, es war die letzte Inanspruchnahme eines anachronistischen Rechts – als Monarch Einfluss auf die Papstwahl nehmen zu wollen.
Interessant ist, dass Franz Joseph I. dazu gedrängt wurde, eher durch seine politischen Berater, etwa den Außenminister, als aus eigenem Antrieb. Man hatte die Möglichkeit eines Veto-Rechts nie formell ausgeschlossen – also nutzte man die Lücke. Ob es tatsächlich wahlentscheidend war, bleibt historisch umstritten. Aber „Was-wäre-wenn“-Fragen sind in der Geschichtswissenschaft unzulässig.
Und dieses Vetorecht ist dann nicht auf den neuen Staat Österreich übergegangen? Der Bundespräsident kann heute also kein Veto mehr einlegen?
Klieber: Nein, es wurde noch 1903 vom neu gewählten Papst unterbunden. Pius X. – übrigens in Venedig geboren, also ein ehemaliger Habsburger Untertan – verbot es künftigen Kardinälen unter Androhung schwerer kirchlicher Strafen, ein Veto zu überbringen. 1918, mit dem Ende der Monarchien, war endgültig klar, dass kein Nachfolgestaat ein solches Recht beanspruchen konnte. Man möchte sich auch gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, hätte jemand wie Hitler oder Franco ein solches Vetorecht besessen.
Was bleibt heute vom habsburgischen Vetorecht oder den damaligen Machtspielen? Beim Begräbnis von Papst Franziskus kamen viele politische Persönlichkeiten zusammen. Auch jetzt beim Konklave scheint der Vatikan wieder Machtzentrum der Welt zu sein. Ist das noch real oder bloß ein Überbleibsel?
Klieber: Es ist ein interessantes kirchenhistorisches Phänomen: Die Päpste haben ihren Kirchenstaat mit Zähnen und Klauen verteidigt – und als sie ihn verloren, gewannen sie paradoxerweise an Einfluss. Ohne weltliche Rücksichten wurden sie stärker als moralische Autorität wahrgenommen. Der päpstliche Hofstaat blieb zwar formal bestehen – mit Botschaftern, Zeremoniell, Leibwachen – fast byzantinisch in seiner Anmutung. Aber de facto wandelte sich das Papsttum zur moralischen Großmacht. Mit der Entstehung weltanschaulich geprägter Gesellschaften mussten Regierungen stärker auf katholische Wähler Rücksicht nehmen. In Deutschland etwa mit der Zentrumspartei – selbst Bismarck musste sich mit dem Papst arrangieren.
Das katholische Milieu – Presse, Vereine, Organisationen – wurde zu einem politischen Faktor. Und der Heilige Stuhl damit zu einer Stimme, auf die man hören musste.
Wir stehen jetzt bald vor einem neuen Papst. Prof. Klieber, haben Sie eine Ahnung oder eine Vorahnung, woher er kommen wird? Einen Namen traue ich mich ja gar nicht zu fragen, weil der Wahlkampf ist ja verboten. Aber ein bisschen spekulieren kann man ja. Haben Sie da eine Vorahnung, eine Tendenz, ein historisches Gespür, wo er denn der neue Papst so kommen könnte?
Klieber: Es ist uns Historikern ja besonders verboten, in die Zukunft zu blicken, weil unser professioneller Blick in die Vergangenheit geht. Aber es gibt vielleicht so gewisse Rhythmen, die man vielleicht hier ins Treffen führen könnte. Etwa, dass es bei Papstbestellungen meistens so etwas wie einen Pendelschlag gegeben hat, wenn auf einen dezidierten Reformer kam und dann in der jemand, der wieder mehr auf Tradition setzt und umgekehrt. Das musste aber nicht im jeweiligen Folge Pontifikat sein, das kann auch so zwei, drei Pontifikate dieses Pendel ausschlagen, je nachdem auch wie lange sie wären. Das jetzige Pontifikat ist ja irgendwie von mittlerer Länge, es war weder überlang noch sehr kurz. Insofern ist es besonders schwierig zu sagen, ob jetzt das Pendel schon wieder in die andere Richtung wird ausschlagen. Wir wissen, es ist ja niemand verborgen geblieben, dass der jetzige Papst mit einem gehörigen Widerständen auch kurial zu kämpfen hatte oder damit rechnen musste, seine Art, das wahrzunehmen, vor allen Dingen auch seine saloppe, volkstümliche Art das wahr zu nehmen, stand ja in der Art krassen Gegensatz auch zu seinem Vorgänger, ich der da ja das zeremonielle und ästhetische da. Ganz anderer Weise hervorgehoben hatte. Auch dieses Plaudern in Mikrofone hat vielen gar nicht gefallen, weil natürlich solche Reden nicht so theologisch ausgeglichen oder austariert sein konnten, wie man sich das bis dato von einem Papst erwartet hat, dass er erst dann öffentliche Äußerungen tätigt, wenn man sich vorher beraten hat und und weiß, welche Folgen das zeitigen kann. Der jetzige Papst hat hier wohltuend eine andere Art vorgelegt, aber es bleibt die Frage nicht, ob das jetzt die sinnvolle oder einzig mögliche Art ist, wie ein Papst zu agieren und zu sprechen hat. Es ist sicher nicht zu erwarten, dass jemand ihn eins zu eins fortführen kann. Also war es zu sehr persönlich geprägt von seinem Werdegang, von seiner Art, von seinen bisherigen Erfahrungen. Es wird auf jeden Fall eine Alternative wieder dazu sein, ob sie, ich glaube, dass gewisse Punkte bleiben werden. Dieses zeremonielle "Shishi" wie vorher, dazu wird, glaube ich, auch ein neuer Papst nicht zurückkehren. Hab'a! Ob man da jetzt alle darauf verpflichten kann, bescheiden in Santa Marta weiter zu wohnen. Ich glaube, wir werden schon hier auch praktische Überlegungen wie der Stadt haben, nicht, dass man in normal gepanzerten Autos vielleicht ausfährt und nicht im Kleinwagen und dass man halt seine normalen Büroräume, die ja auch nicht, weiß Gott, wie überall prunkvoll sind, das war ja eher Stil des 20. Jahrhunderts, der 50er-, 60er-Jahre. Denen da das Papstbüro ausgestattet. Wahrscheinlich geht es auch zurück in eine vielleicht etwas überlegtere theologische Fundierung der Aussagen. Der jetzige Papst war in manchen Punkten hier doch ungestimmt oder auch wirklich unvorsichtig. Er musste dann ja auch immer wieder zurückrudern oder er hatte auch das Problem, dass er Erwartungen geweckt hat, die er letztlich nicht einlösen konnte.
Auf jeden Fall danke für dieses Bild des Pendels. Schauen wir mal, wohin es ausschlägt. Jedenfalls danke an den Kirchenhistoriker Robert Klieber, mit dem ich heute über Papstwahlen und habsburgerische Machtpolitik gesprochen habe. Es war eine Folge von Diesseits von Eden. Danke sehr.