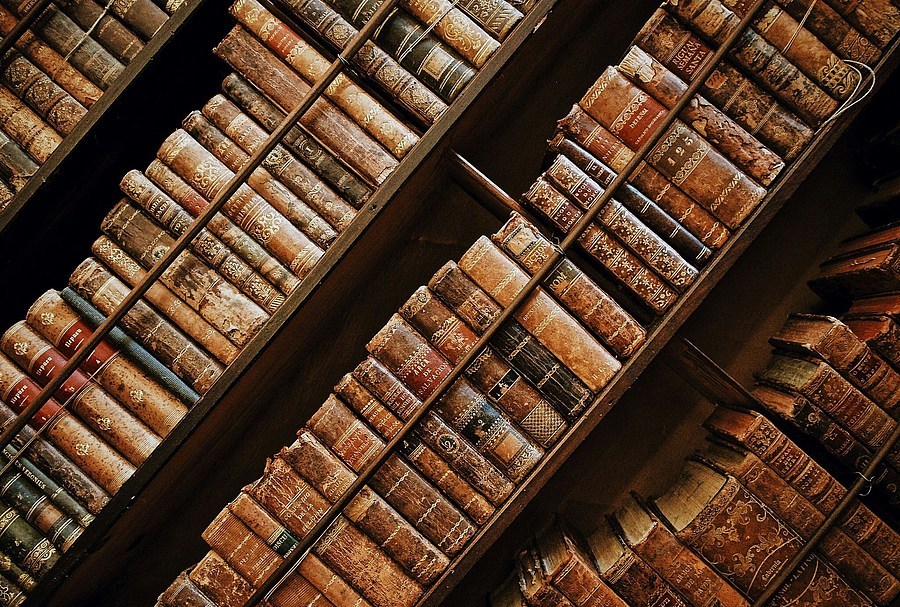Vor 60 Jahren endete das Zweite Vatikanische Konzil: Was bleibt (und warum es ein neues Konzil braucht)

Foto: Lothar Wolleh, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Podcast vom 8. November 2025 | Gestaltung: Henning Klingen*
Für die einen ist es das größte katholische kirchliche Ereignis des 20. Jh. mit vielen offenen Baustellen bis heute. Für die anderen ist es das Menetekel der katholischen Kirche – der Anfang vom Ende katholischer Herrlichkeit. Gemeint ist das Zweite Vatikanische Konzil. Die vier Jahre andauernde Versammlung aller katholischen Bischöfe in Rom. Vor 60 Jahren – am 8. Dezember 1965 – endete es. Insgesamt wurden 16 Dokumente veröffentlicht, die die katholische Kirche nachhaltig verändert haben. In der letzten Sitzungsperiode wurden die meisten verabschiedet.
Den Schlussstein bildete am 7. Dezember 1965 "Gaudium et spes", die Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute. Oft zitiert eine Passage aus dem Einstieg in das Dokument: "Zur Erfüllung ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten." Mmm, ja, eh, mag man heute da vielleicht sagen. So what… Aber tatsächlich hat "Gaudium et spes" eine Art kirchlichen Vibe-Shift gebracht oder vielmehr amtlich festgeschrieben: "Die Welt" hat Relevanz für die Kirche; sie ist nicht nur ein Ort, den es zu missionieren gilt, sondern sie hat in ihrer ganzen Vielfalt und auch Widersprüchlichkeit der Kirche etwas zu sagen und zu geben. Mmmm ja, eh, könnte man wieder sagen. So what…?
Eine Frage, die ich heute hier bei "Diesseits von Eden", dem Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich, an drei ExpertInnen weiterreichen möchte. Mein Name ist Henning Klingen – und ich freue mich auf ein Gespräch mit Michaela Quast-Neulinger, sie forscht und lehrt als Assistenzprofessorin am Institut für Systematische Theologie der Universität Innsbruck; dann begrüße ich Gregor Maria Hoff, er ist Professor für Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie an der Uni Salzburg. Und ebenfalls aus Salzburg zugeschaltet: Dietmar Winkler; er ist Professor für Patristik und Kirchengeschichte.
Gaudium et spes als "hermeneutischer Schlüssel" des Konzils?
Frau Quast-Neulinger, vielleicht zunächst an Sie gefragt: Ist meine Einleitung eigentlich gerechtfertigt, in dem Dokument „Gaudium et spes“ so etwas wie einen „hermeneutischen Schlüssel“ des Konzils zu sehen? – Und was steht sonst noch in dem voluminösen Dokument außer der Sache mit den „Zeichen der Zeit“?
Quast-Neulinger: Dem kann man durchaus zustimmen, dass Gaudium et spes eine kopernikanische Wende ist. Aber man muss die ganzen Dokumente natürlich immer miteinander lesen. In dieser letzten Sitzungsperiode wurde ja nicht nur Gaudium et spes verabschiedet, sondern auch Dignitatis humanae und – ein paar Wochen zuvor im Oktober – Nostra aetate. Und ich glaube, gerade diese drei Dokumente sind nicht unabhängig voneinander zu verstehen, sondern sie spielen sich gegenseitig auch immer wieder Bälle zu und sind auch in der Entstehungsgeschichte untereinander verwoben. Drei Dinge, die diese drei verbinden, sind, dass sie an alle Menschen gerichtet sind, dass sich Kirche darin zeigt als eine Dienerin aller, nicht als Machtinstrument oder als Machtinstitution, und das Prinzip der Geschwisterlichkeit und des universalen Dialogs mit allen wird betont. Ich glaube, das verbindet diese drei, und diese Momente sind heute so aktuell wie schon lange nicht mehr.
Vielleicht muss man sich vor Augen führen, dass diese Konzilsdokumente eine Geschichte haben, heiß umstritten waren. Es gibt Schemata, also Vorlagen, um die gerungen, an denen gearbeitet wurde. An Gregor Hoff und Dietmar Winkler gefragt: Welche Entwicklungsgeschichte lässt sich denn in groben Zügen für „Gaudium et spes“ feststellen?
Gregor Maria Hoff: Du machst zu Recht darauf aufmerksam, dass es Schemata gegeben hat. Und vielleicht ist der erste Schritt auf dem Weg hin zu einer Konstitution wie Gaudium et spes, dass das Konzil sich förmlich selber ermächtigt und emanzipiert von all den vorbereiteten Schemata der Kurie. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, damit eben so etwas wie eine konziliare Mehrstimmigkeit entsteht, die es ermöglicht, von den verschiedenen Kontexten aus darüber nachzudenken und deren Relevanz einzuspielen: Was heißt es eigentlich heute, das Evangelium zu kommunizieren? Bei Gaudium et spes ist das nicht zuletzt daran zu sehen, dass es ein langes Ringen um diese Konstitution gegeben hat und eine enorme Kritik; auch die Rezeptionsgeschichte ist sehr umwegig. Sie ist so konfliktiv wie das Entstehen des Textes selbst. Es gibt acht Textfassungen. Es gibt schon vorher eine Art von Bahnlegung; die kann man darin sehen, wie Johannes XXIII. seine Idee von diesem Konzil entwickelt und da eben auch Leitmarken bereits setzt. Michaela Quast-Neulinger hat ja darauf hingewiesen: Es geht um alle Menschen, und damit ist ein weiter Fokus verbunden, eben tatsächlich das, was man die anthropologische Wende dieses Konzils nennt. Bei diesen acht Textfassungen stellt man fest: Immer wieder werden bestimmte Akzente aufgerufen und wieder verworfen. Aber als ein Leitmotiv, das Gaudium et spes – gerade auch in Beziehung zu Lumen gentium, also der dogmatischen Konstitution über die Kirche – ausmacht, steht diese Innen- und Außenrelatio. Kirche muss ad intra und ad extra sprechen, und das ist keine Rangordnung, sondern eine Wechselwirkung, wenn man so will. Und dieses Wechselwirkungsprinzip von Innen- und Außenrelation hat eine enorme Konsequenz. Michaela Quast-Neulinger hat ja auch darauf hingewiesen: Es sind ja in dieser letzten Sitzungsperiode auch andere Dokumente verabschiedet worden, und die haben genau mit dieser Grammatik zu tun – also bezogen auf die anderen Religionen und zumal auf das Judentum hin, aber auch Dignitatis humanae, dass die Rede von Menschenwürde und Menschenrechten, Religionsfreiheit, zu einer Bestimmungsform wird, wie das Konzil sich heute, sprich 1965, adressiert.

Prof. Gregor Maria Hoff, Salzburg
"Die Kirche geht ganz weit über ihre Grenzen hinaus"
Wenn man hier in Wien ins Kardinal-König-Archiv geht, kann man diese Konzilsvorlagen von Kardinal König auch noch einsehen. Das ist hochinteressant. Da findet man nämlich seitenweise durchgestrichene Passagen in diesen Schemata. An der Seite liest man dann Kommentare wie „Das Ganze ist ein erbärmliches philosophisches Machwerk“ und Ähnliches. Das sind die Kommentare von Karl Rahner, damals als Konzilsberater von Kardinal König. Dietmar Winkler, gibt es da noch etwas dazuzulegen aus kirchenhistorischer Sicht?
Dietmar Winkler: Ich möchte anschließen an das, was Gregor Hoff und Michaela Quast-Neulinger gesagt haben: Diese Innen-Außen-Perspektive des Konzils zeigt sich in einer Art konzentrische Kreise. Man muss sich vorstellen: Alle Konzilsväter sind "vorkonziliar" erzogen worden, haben in diesem Kontext ihre Theologiestudien gemacht, und jetzt vollzieht sich in diesem Prozess des Konzils mit den Sitzungsphasen etwas Erstaunliches: Letztendlich gibt die katholische Kirche ihren Absolutheitsanspruch auf, aber nicht den Wahrheitsanspruch – und das finde ich sehr spannend: Mit „konzentrischen Kreisen“ meine ich, dass sie sich vor dem Konzil in der offiziellen Theologie als "die eine katholische Kirche" gesehen hat. Und der erste konzentrische Kreis geht dann sozusagen über die Kirchenkonstitution und über das Ökumenismusdekret dahin, dass man ein Verständnis entwickelt: Ja, wir sind die wahre Kirche – aber wir sind sie nicht alleine, sondern es gibt außerhalb, in den ersten konzentrischen Kreisen, auch Kirchlichkeit. Man hat das „Elemente der Kirche“ genannt. Also, da habe ich einen ersten konzentrischen Kreis. Und der reicht dann bis in die letzte Konzilsphase und zu Nostra aetate und den Schritt zu den anderen Religionen hinein. Wobei Nostra aetate auch eine interessante Entwicklung hat: von einer "Judenerklärung", die missglückt ist, hin zu einer interreligiösen Erklärung. Und dann kulminiert das Ganze in Dignitatis humanae; und das, was Michaela Quast-Neulinger als kopernikanische Wende bezeichnet hat, würde ich eben genau bei Dignitatis humanae sehen, denn da bin ich plötzlich bei der ganzen Menschheit: also die Würde des Menschen und die Personenrechte kommen hinein – unabhängig vom Glauben oder ob überhaupt geglaubt wird. Das heißt, die Kirche geht in erstaumlichem Maße ganz weit über ihre Grenzen hinaus.
Gregor Maria Hoff: Dietmar spricht zu Recht das Stichwort „erstaunlich“ an: Da passiert etwas, was letztlich fast unvorhersehbar ist – also wenn man sich die Schemata anguckt, muss man einfach mit etwas ganz, ganz anderem rechnen. Gleichzeitig gibt es darin etwas, das bei all dem, was erstaunt und dann eben auch zu echten Überraschungen führt, im Rückblick für mich eine Art von indirekter Wahrscheinlichkeit hat – und zwar deshalb, weil der Problemdruck für die katholische Kirche in sehr, sehr vielen Feldern, die dann eben auch gerade von unseren heute zu diskutierenden drei Dokumenten bearbeitet werden, enorm ist. Es geht um das Verhältnis zur modernen Welt. Und es zeigt sich, dass das antimodernistische Paradigma zwar milieubezogen vielleicht noch hier und da funktioniert, aber jedenfalls keine kommunikative Wirksamkeit mehr hat. Es erschöpft sich. Genauso entkommt man vom Problemdruck her nicht der Realität der anderen, der nichtchristlichen Religionen. Und Dietmar hat es angedeutet: Also jetzt die sogenannte Judenerklärung, die ja als Ausgangspunkt stand – dazu wurde letzte Woche in Rom bei der Feier zu Nostra aetate sehr deutlich gesagt, dass man dem Thema Judentum nach der Shoah nicht ausweichen kann. Es gibt mehrere richtige Paradigmenwechsel; ich will allerdings auch sagen, dass wir es auch nach wie vor zum Teil mit inneren Widersprüchen zu tun haben – da sind Dinge nicht ausgeglichen in den Textpartien. Das ist auch ein Ausdruck davon, wie konfliktiv das Konzil gewesen ist. Das halte ich aber ausdrücklich für einen Vorteil! Denn es zeigt: Man ist imstande gewesen, mit diesen Konflikten produktiv umzugehen.
Bevor wir zu den anderen Dokumenten kommen, die jetzt gerade schon angesprochen wurden, noch einmal zu „Gaudium et spes“ eine Rückfrage: Frau Quast-Neulinger, da wird ja sehr generös von „der Welt“ und „der Kirche“ geredet, also in großen Kategorien. Ist das überhaupt heute noch anschlussfähig, entspricht das also noch der soziologischen Realität? Inwiefern sind Aussagen, die ein Konzil vor 60 Jahren zur Welt machte, eigentlich noch brauchbar und Arbeitsgrundlagen für heutige Theologie?
Quast-Neulinger: Vielleicht ist es genau unser Fehler, dass wir nicht mehr von "der Welt" sprechen und nicht mehr zu diesem Einheitsdenken in Vielfalt in der Lage scheinen. Denn ich glaube, die große Stärke des Konzils, und vor allem von Gaudium et spes, ist es, diese Einheit und die Vielfältigkeit zusammenzudenken. Man sieht ja im Vorwort zu Gaudium et spes den Aufruf oder das Bekenntnis dazu, dass man weiß: Ja, man legt jetzt einmal etwas vor, aber das, was vorgelegt ist, muss dann in den jeweiligen Kontexten interpretiert werden – und der Aufruf, ganz am Ende von Gaudium et spes, auch wieder an die jeweiligen Umstände anzupassen. Das heißt, Gaudium et spes versteht sich nicht als ein für alle Mal festgelegte Lehre. Die große Herausforderung von Gaudium et spes und dem Konzil für heute ist beides: weit zu denken, die Pluralität der Welten zu denken und die verschiedenen Herausforderungen – aber darin auch die Einheit zu suchen, zu finden und damit das dialogische Moment wieder hervorzubringen. Wenn wir einen Schritt weiter gehen zu Nostra aetate, dann heißt es ja da im ersten Abschnitt schon, der Auftrag der Kirche ist die Förderung von Einheit und Liebe unter den Völkern. Und das heißt: Kirche versteht sich als Dienerin an der Einheit. Und da zeigt sich wieder diese Spannung zwischen Einheit und Vielfalt. Im übrigen bin ich der Meinung, dass ein wesentliches Kennzeichen der Konzilstheologie die inkarnatorische Logik ist: Kirche ist immer schon in die Welt gerufen, so wie Gott Fleisch geworden ist. Daher kann sie gar nicht anders und sollte gar nichts anders, als in der Welt sein und sich in Beziehung zu dieser Welt setzen. Und diese inkarnatorische Logik ist aber immer zugleich eine kenotische, das heißt eine, die auf institutionelle Macht in der Welt freiwillig verzichtet und ihre Macht auf andere Art und Weise entfaltet, nämlich als Überzeugungsmacht. Und das zeigt sich dann in Dignitatis humanae, dass die Wahrheit aus sich selbst heraus überzeugt und keinen Zwang braucht – ja sogar auf Zwang verzichten muss.

Prof. Michaela Quast-Neulinger, Innsbruck
Dietmar Winkler: Ich würde das gern verbinden mit einer Sache, die außerhalb des Zweiten Vatikanischen Konzils stattgefunden hat – nämlich vor der Verabschiedung dieser Dokumente, und zwar am 4. Oktober 1965. Da geht Papst Paul VI. als erster Papst in der Geschichte überhaupt zur UNO und spricht vor der UNO, und das muss man durchaus im Kontext von Dignitatis humanae – also der Deklaration über die Würde des Menschen und die Rechte der Person – sehen und auch im Kontext von Gaudium et spes: Vor der UNO macht der Papst deutlich, dass die katholische Kirche bereit ist, international eine Rolle zu spielen als globaler Akteur – aber anders als bisher, d.h. nicht im Sinne des Ersten Vatikanischen Konzils mit einem Primatsanspruch und einem universalen Jurisdiktionsprimat, sondern im Sinne einer globalen Verantwortung für die Menschheit. Das ist ein Ausdruck dafür, wie sich das Papsttum zu einem globalen Akteur entwickelt - was ja bis heute durchaus der Fall ist, wenn man an die päpstlichen Friedensinitiativen und -aufrufe denkt. Das fußt alles auf dieser Rede von Papst Paul VI. vom 4. Oktober 1965 vor der UNO, wo man bereits die Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils auch extern wahrnehmen konnte. Die Kirche beginnt, in der Welt Verantwortung zu übernehmen.
Kirche, Menschenwürde & Menschenrechte
Vielleicht sollten wir kurz erklären, was es mit „Dignitatis humanae“ auf sich hat, also der Erklärung über die Religionsfreiheit. Ihr Vorgänger, Roman Siebenrock, hat dazu gesagt, das sei eine „kaum zu überschätzende Wende in der kirchlichen Praxis und in der dogmatisch-regulativen Grundausrichtung von Kirche“ gewesen. Was meint er damit, Frau Quast-Neulinger?
Quast-Neulinger: Ganz kurz zusammengefasst: Personen haben Rechte – nicht die Wahrheit oder der Irrtum hat Rechte. Die Person rückt ins Zentrum, das Gewissen der Person, die unveräußerliche Würde des Menschen. Und von dieser Überzeugung aus entfaltet sich das Ganze hinaus in die Breite – und in die große Herausforderung, vor der wir heute wieder stehen.
Gregor Maria Hoff: Von Menschenwürde zu reden – darin ist die Kirche gut; von Menschenrechten zu sprechen – damit tut sie sich etwas schwerer. Sie tut sich schwer damit, der Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen aus unterschiedlichen Gründen beizutreten, weil sie immer das Gottesrecht am Ende doch noch einmal letztlich als einen Vorbehalt ins Spiel bringt – das heißt eben offenbarungstheologisch argumentiert. Also: So weit ist es dann auch in dem Punkt bis heute mit der ekklesiologischen Kenosis nicht so richtig weit. Aber sie tut sich auch deshalb schwer – das sehen wir ja gerade in den synodalen Prozessen, die sich ganz gezielt ja auch auf das Konzil berufen –, wenn es um die Menschenrechte geht, etwa in der Frage: Was bedeutet das für die Rolle der Frau in der Kirche, Stichwort Ordination? Was bedeutet das für Menschen, die in homosexuellen Partnerschaften leben? Was bedeutet das für Menschen mit queerer geschlechtlicher Selbstbestimmung usw.? Was bedeutet das wirklich? Übrigens zeigt sich das auch in der Art und Weise, wie die katholische Kirche mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt und geistlichem Missbrauch umgeht. Menschenrechte in offener …
Was ist denn tatsächlich der praktische Anwendungsfall für „Dignitatis humanae“?
Quast-Neulinger: Also, ein paar Testfälle haben wir schon bei Gregor Maria Hoff gehört, wo es wirklich um die praktische Anwendung geht. Aber ich glaube, unsere heutige Krise rund um Dignitatis humanae geht noch viel tiefer, nämlich dass Menschenwürde tatsächlich universal ist und dass sie jedem einzelnen Menschen qua Menschsein zusteht bzw. ihm gegeben ist. Das ist nämlich das Entscheidende von Dignitatis humanae: Die Religionsfreiheit ist nicht einfach ein Recht, das jemand großzügigerweise hergibt – also ein Machterweis oder Gnadenerweis von irgendeiner Institution –, sondern Dignitatis humanae schärft ein: Das ist dem Menschen eingeschrieben, jedem einzelnen Menschen. Das müssen wir immer wieder betonen und verteidigen. Heute leben wir in einer Zeit, wo gerade aus den USA massive Infragestellungen von Menschenwürde kommen, gerade auch aus dem katholischen Bereich, Stichwort Neointegralismus. Diese Denkform sagt: Dignitatis humanae anerkenne nicht Religionsfreiheit als Recht des einzelnen Menschen, sondern es gehe nur um die Freiheit der Kirche, zu entscheiden, und die Freiheit der Kirche, den weltlichen Arm für ihre eigenen Interessen zu nutzen, die eine Wahrheit durchzusetzen. Das ist eine Interpretation, mit der 99 Prozent der Theologinnen und Theologen nicht übereinstimmen. Aber diese Interpretation ist leider verbunden mit großen Finanz- und Machtinteressen. Und daher müssen wir uns diesen Interpretationen wohl oder übel stellen und sie zurückweisen und klar in die Grenzen weisen.

Prof. Dietmar Winkler, Salzburg
Dietmar Winkler: Ich habe eine Rückfrage an Michaela Quast-Neulinger als Expertin für den Dialog mit dem Islam: Wir sagen immer, die Menschenrechtserklärung sei universal. Dann gibt es aber die muslimische Kairo-Erklärung der Menschenrechte, die das herausfordert – wie gehen wir denn damit um? Und auch intern müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass Dignitatis humanae hinterfragt wird. Insgesamt müssten wir also eigentlich immer wieder unterstreichen, dass wir ein tolles Dokument haben, um die Menschenrechte auch universal zu schützen, die von anderen Kulturkreisen und Religionen herausgefordert sind. Wie sollen wir damit umgehen?
Quast-Neulinger: Der Missbrauch von Religionsfreiheit gegen Religionsfreiheit ist eines der großen Probleme unserer Tage – neben vielen anderen –, aber das ist echt ein zentrales Problem. Erstens: Ich trete momentan dafür ein, die Dignitatis humanae zu verteidigen, und zwar universale Religionsfreiheit – theologisch, juristisch und vor allem auch offenbarungstheologisch begründet. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, an der wir noch arbeiten müssen. Unser Problem heute ist auch, dass wir auf der einen Seite Kräfte haben, die jetzt katholisch auftreten und sagen: Religionsfreiheit nur für uns, aber nicht für die anderen. Und genau dasselbe Moment haben wir aber auch in anderen Religionsgemeinschaften, die diese Wende machen – von islamischer Seite, aber auch von jüdischer oder hinduistischer Seite –, wo gesagt wird: Religionsfreiheit nur für „uns“, aber nicht für die anderen. Und das ist das Kernproblem. Wenn Freiheitsrechte, dann für alle – das muss gut ausverhandelt werden. Und da braucht’s einfach auch den Dialog und den Rahmen dafür. Aber wenn ich abrücke von einem gut begründeten Universalismus, den ich dann partikular verankern muss in den jeweiligen religiösen und kulturellen Traditionen, dann haben wir wirklich ein ganz massives Problem.
Eine Chance für das Lehramt der katholischen Kirche?
Gregor Maria Hoff: Du hast ja gefragt: Wie geht man damit um? – Also innerhalb der katholischen Kirche gibt es dafür eine vergleichsweise einfache Möglichkeit. Erstmal möchte ich ausdrücklich betonen, dass das Lehramt der Päpste seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil an diesem Punkt eine sehr konsequente Entwicklung verfolgt hat und eigentlich da kein Zweifel daran besteht. Das hat auch damit zu tun, dass gerade auch in diesem Kontext eine ganz wichtige Rolle gespielt worden ist – sowohl für die Dignitatis humanae als auch für Gaudium et spes in diesem gesamten Zusammenhang. Und es gibt Weiterentwicklungen. Wir müssen nur an Abu Dhabi denken, was Franziskus da gesagt hat, und wenn wir uns auf Nostra aetate schauen, gibt es dort ja auch einen förmlich revolutionären Satz, nämlich dass die Pluralität von Religionen von Gott gewollt sei – ich paraphrasiere. Mir geht es in diesem Augenblick aber vor allen Dingen um Religionsfreiheit, wie man sie dann eben aus katholischer Sicht auch in politischen Konflikten stark machen kann. Offen gesagt, hängt es einfach an Besetzungspolitik in den USA: In dem Maße, in dem der Papst – und wir haben ja jetzt einen Papst mit amerikanischen Wurzeln, der ja auch durchaus das offene Wort als Kardinal nicht gescheut hat gegenüber den „Baby-Katholiken“, wie er sich selber bezeichnet – klare Worte findet, kann man wirklich auch erwarten, dass scharfe disziplinarische Maßnahmen gesetzt werden – wie bei Theologen und Theologinnen auch –, wenn sie den Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils so verlassen, dass man vorkonziliar wird. Und dass man das Konzil weiterentwickeln muss – das haben die Päpste getan. Aber da muss man einfach ganz klare und harte Politik betreiben. Man muss sich Verbündete suchen. Da, glaube ich, gibt es einen ganz klaren, manifesten Spielraum.
Dietmar Winkler: Das mit dem ordentlichen Lehramt möchte ich aus kirchenhistorischer Sicht hinterfragen. Denn das ordentliche Lehramt, so wie wir es heute haben, ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, und das hat es so nie gegeben. Und die Bischöfe berufen sich sehr gerne jetzt darauf. Das heißt, wir müssen eigentlich synodal und konziliar denken, wenn wir wirklich in der Tradition der Kirche sein wollen. Das ist nicht nur das erste Jahrtausend mit den ökumenischen Konzilien und mit der Synodalität. Wir haben selbst im Westen die mittelalterlichen Synoden und das Denken in Synoden. Das heißt: Wenn gesagt wird, dass Dignitatis humanae jetzt dringend und gut weitergedacht wird von den Päpsten, dann ist das genau der Punkt. Der Ausgangspunkt ist das Konzil: Das Konzil ist diese Note, die hier sozusagen gemeinschaftlich zur Entscheidung gekommen ist. Wie ein Konzil auszusehen hat, wäre noch weiterhin zu diskutieren. Bis ins dritte Jahrhundert ist „Konzil“ viel vielfältiger; ab dem vierten wird es dann eine Bischofsversammlung. Das kann man sehen – also … Deshalb ist der Prozess sehr gut, dass wir jetzt über Synodalität nachdenken. Das heißt: Die Päpste sind dann weitere Interpretatoren des Konzils und haben hier eine Verantwortung, so wie wir das eher sehen. Aber sie sprechen jetzt nicht ex officio mit irgendeiner Enzyklika dann ein neues Dogma aus oder wie auch immer – das geht aus meiner Sicht nicht. Das muss im Kontext eines Konzils geschehen. Und von dem her ist die Überwindung von Konflikten, wenn es jetzt um Spaltungen usw. geht, eben genau wieder eine Sache eines Konzils, de facto. Das war immer in der Kirchengeschichte so: Wenn’s ein Problem gibt, dann ruft man sich zusammen. Man kommt dann zu einer Gemeinschaft zusammen – in seiner Zeit waren es die Bischöfe; seinerzeit meine ich also vor der konstantinischen Wende. Später war dann plötzlich der Kaiser zuständig und dann im Westen war es noch einmal der Papst, der das einberufen hat. Und dann hat man diese Konflikte versucht zu bewältigen. Noch einmal zurück aus historischer Sicht: Zweites Vatikanisches Konzil – wenn man sieht, welche Spannungen hier überwunden worden sind, wenn wir die verschiedenen Schemata, die wir am Anfang besprochen haben, ansehen, und ich habe dann zum Schluss bei den Abstimmungen 3–5 % Gegner, die nach wie vor da sind – die hat man dann später unter Lefebvrianern kennengelernt usw. –, dann ist das praktisch nichts im Vergleich zu dem, was wir in Synoden und Konzilien in der Kirchengeschichte gehabt haben. Wenn wir heute Spaltungen und Trennungen haben, dann heißt es eben: gerade wieder zusammenkommen – in einer Synode (das ist das Griechische) oder in einem Konzil. Das ist durchaus positiv zu betrachten. Wie das dann konkret auszuschauen hat, ist eine nächste Frage. Aber das Konzil ist der genuine Platz zur Überwindung von Spannungen und um den nächsten Schritt zu machen.
Quast-Neulinger: Da kann ich sehr gut anschließen. Ich möchte nicht missverstanden werden, wenn ich vorhin vom Lehramt gesprochen habe – das meine ich nicht in einem zentralistischen Sinne –, aber am Ende müssen Entscheidungen getroffen werden, auch lehramtliche Entscheidungen. Was ich sehr wohl glaube – und da kann ich jetzt gut anschließen: Wir leiden immer noch unter dem 19. Jahrhundert, und zwar offenbarungstheologisch und mit Blick darauf, wie wir Autorität verstehen. Und da ist ein großer Brocken, den wir zu bearbeiten haben. Konzilien sind immer Antworten auf Konflikte, die dort ausverhandelt werden. Aber ich glaube, wir müssen einen guten Weg finden, wie wir uns dort treffen und dass wirklich dieses Dialogische und Aufeinander-Hinhören ernst genommen wird – und dass es wirklich zu einem Zusammenspiel der unterschiedlichen loci kommt; und das heißt auch zu einem Zusammenspiel und wirklichen Aufeinanderhinhören der universitären Theologie, der verschiedenen Orte, wo Theologien entstehen, der verschiedenen Ortskirchen. Und dass wirklich diese Pluralität zusammenkommt und man sich gegenseitig auch ernst nimmt und einfach zuhört. Ich glaube, man hat vieles probiert in den letzten Jahren im Rahmen des synodalen Prozesses. Und bevor ein Konzil gelingen kann, braucht es vielleicht auch die Kultur – oder vielleicht auch nicht. Wir haben ja über das Konzil, das Zweite Vatikanum, gesprochen und die überraschenden Ausgänge, dass vieles auch erst dort auf dem Konzil entstanden ist – überraschenderweise gekommen ist, vielleicht auch durch Gnade, durch Geist, wie auch immer man das bezeichnen mag. Aber dieses Lob der Vielfalt in der Einheit – das wäre ein sehr wichtiges Moment.
"Auf Dauer kommen wir an einem Konzil nicht vorbei"
Gregor Maria Hoff: Das, wo ich besonders anknüpfen kann, ist das, was Dietmar Winkler als Kirchenhistoriker mit einer sehr breiten Expertise – gerade auch im Blick auf die Altkirchen, im Blick auf das, was Konzilien für die Kirchen des Ostens, die Orthodoxie usw. bedeuten – sagt: Konzilien sind nicht zuletzt eben auch Problemlösungsorte und Instanzen in Augenblicken, in denen Entscheidungen notwendig sind. Ich schließe mich Michaela Quast-Neulinger an, etwas fortgeführt: Wir brauchen für eine synodale Transformation der katholischen Kirche sicherlich noch Zeit. Es läuft ja jetzt auch die Implementationsphase, die vorgesehen ist – vom Abschlussdokument der Synode letztes Jahr –, die eingeleitet worden ist (einer der letzten Akte, die Papst Franziskus gesetzt hat), und Leo hat sie direkt am Anfang aufgegriffen. Das heißt, wir werden dafür Zeit brauchen. Aber irgendwann wird man bestimmten Entscheidungen nicht ganz entkommen können. Wir werden sicherlich mit den ortskirchlichen Traditionen auch in unterschiedlichen – wie soll man sagen – Entscheidungsmodi arbeiten können: Frauenordination – an einem bestimmten Punkt probieren wir dies und das aus; bezogen auf die Zulassung von Menschen in homosexuellen Partnerschaften: Ist mehr als – vielleicht sogar – nur ein Segen möglich? Also, es gibt schon auch da ein paar Pluralitätsmomente, aber auf Dauer kann sich nicht – menschenwürde- und menschenrechtsbasiert – in der katholischen Kirche auf der einen Seite ausschließen, was die andere Seite als essenziell betrachtet. Deswegen werden wir irgendwann ein Konzil brauchen – aus einem anderen Grund: Ich denke, dass die Themen und die Prozesse, gerade die gesellschaftlichen, religionskulturellen, die politischen Prozesse seit dem Konzil, eine Dynamik haben, die damals nicht absehbar gewesen ist und mehr als nur Themen verändert. Die beschworene anthropologische Wende stellt uns heute vor die Frage: Was bedeutet eine anthropologische Wende im Zeitalter des Anthropozän? Wir müssen schöpfungstheoogisch anders denken; wir müssen an vielen Punkten – nicht zuletzt im Horizont von Digitalisierung – nicht nur die technische Seite von Digitalisierungen im Blick haben, sondern dass es eine veränderte Ordnung von Wissen ist. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir an einem Konzil auf Dauer nicht vorbeikommen – wenn es gut vorbereitet ist durch synodale Transformationsprozesse, wenn Synodalität bei uns insgesamt einfach auch eine geistliche, aber auch eine handlungspraktische Form ist, Kirche und katholisch zu sein, haben wir dafür gute Chancen. Aber die Konflikte kommen ohnehin. Das, was unter Säkularisierungsbedingungen an Kirche noch bleibt, stellt uns vor eine ganz eigene Herausforderung. Das rechtskatholische Moment wird bei uns stärker werden. Und auch das ist etwas, was ein Thema für ein Konzil ist, wenn eine Kirche sich aus einer offenen wiederum in eine geschlossene Gesellschaft zu wandeln droht.
Das bringt mich zum Abschluss jetzt dazu, wieder der alten Fußballer-Weisheit zuzustimmen: Nach dem Konzil ist vor dem Konzil … Vielen Dank in die Runde für dieses lebendige Gespräch. Wenn auch Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.