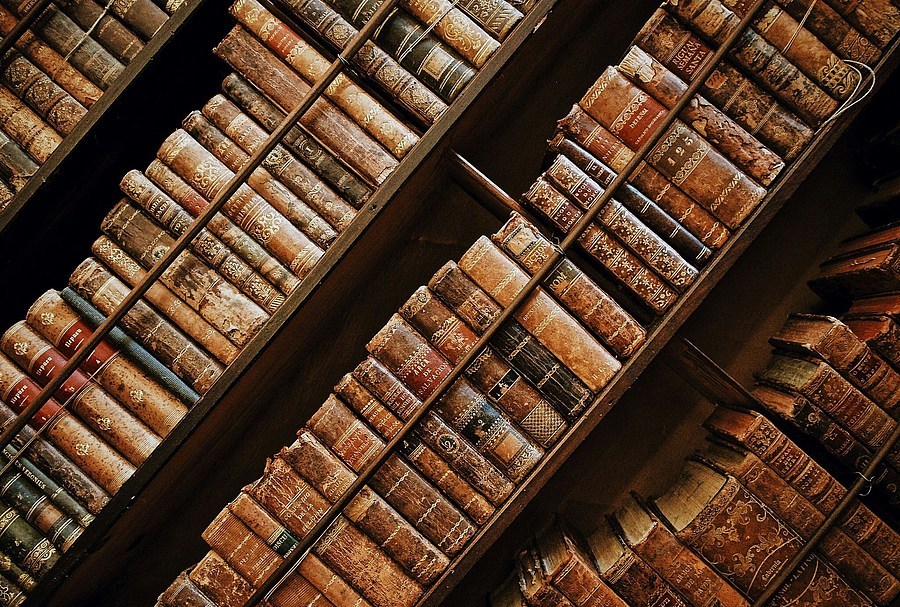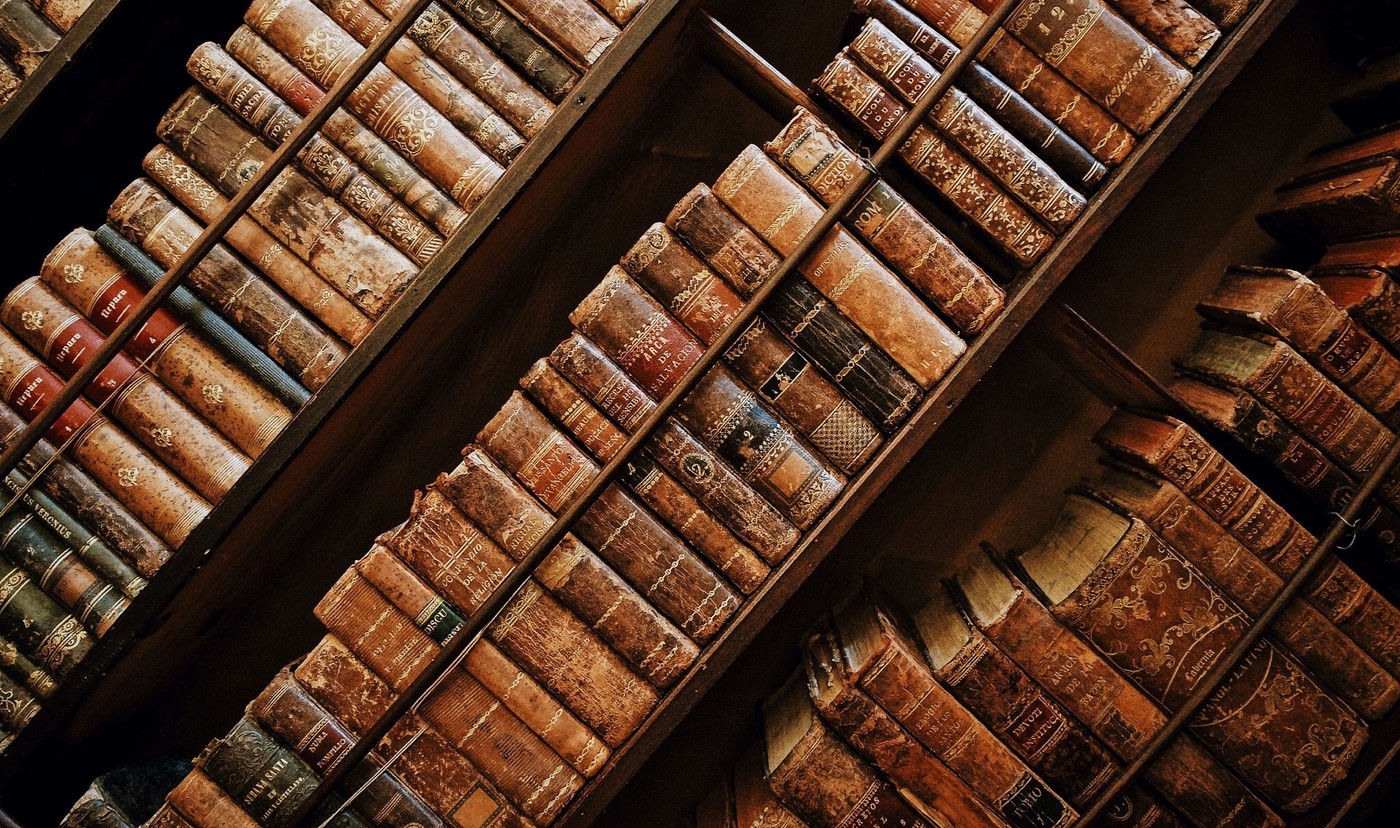Freiheit im Denken, Freiheit im Glauben: 200 Jahre Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien

Podcast vom 12. Oktober 2021 | Gestaltung: Henning Klingen*
Wenn man auf der Straße herumfragt, worin denn der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch besteht, wird man – vermutlich – in fragende Gesichter blicken. Tatsächlich ist es selbst unter Theologie-Studierenden nicht immer ganz leicht, treffsichere Antworten auf die Frage zu bekommen, was denn das konfessionelle Alleinstellungsmerkmal ist. Ein Problem, unter dem auch die universitäre Theologie leidet, die sich noch dazu nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern auch in der akademischen Welt bewähren und behaupten muss. An der Wiener Universität etwa gibt es eine katholische Theologie seit fast 640 Jahren. Und die evangelische Fakultät? – Auch die kann auf eine inzwischen lange und vor allem starke Tradition im traditionell katholischen Österreich verweisen. Sie besteht nämlich seit exakt 200 Jahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Diesseits von Eden" sagt Henning Klingen.
Evangelische Theologie in katholischem Umfeld. So könnte man sagen. Und doch oder vielleicht gerade deshalb: eine starke Theologie, eine starke Fakultät. Seit März dieses Jahres feiert die Fakultät, die gemeinsam mit der katholischen Fakultät und dem Institut für islamische Studien in der Wiener Schenkenstraße untergebracht ist, ein Jubiläumsjahr – mit Vorlesungen und zuletzt in diesen Tagen mit einer mehrtägigen, hochkarätig besetzten Festveranstaltung. Darüber werden wir ein anderes Mal berichten – hier soll es nun zunächst um die Fakultätsgeschichte und um das Proprium evangelischer Theologie und ihre Zukunftsfähigkeit insgesamt gehen.
Vom Toleranzpatent zur evangelischen Lehranstalt
Beginnen wir mit der Geschichte der evangelisch-theologischen Fakultät. Diese beginnt mit einem sehr konkreten Datum: dem Toleranzpatent vom 13. Oktober 1781. Damit erlaubte Kaiser Joseph II. im Zuge des der Anerkennung des Protestantismus durch den Westfälischen Frieden, den Kirchen der Reformation die freie Religionsausübung in den Habsburger Kronländern. Der vormals im Untergrund organisierte Geheimprotestantismus durfte nun öffentlich sichtbar gelebt werden. Über 1.000 Gemeinden entstanden in Folge auf dem damaligen Gebiet der Monarchie. Gemeinden, die nach Seelsorgern verlangten. – Diese jedoch kamen allesamt aus dem Ausland, aus den Ländern des Deutschen Bundes, wo bereits evangelische Fakultäten bestanden.
Der Wiener evangelische Kirchenhistoriker Rudolf Leeb erklärt, wie das zur Gründung der evangelisch-theologischen Lehranstalt geführt hat:
"Dass man aber dann doch zu der Gründung einer theologischen Lehranstalt schritt, war begründet durch zwei Faktoren: einmal mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806. Damit wurden auch die österreichischen Länder von den alten Reichsgebieten losgelöst. Und da gibt es schon die ersten Versuche und Initiativen vom Staat, eine Fakultät zu gründen. Der zweite Anstoß, der hinzukam: Die Monarchie und der Metternichsche Staat haben mit Misstrauen gesehen, dass sich vor allem in Deutschland liberale Ideen ausbreiteten. Es gab das Wartburgfest der Studentenschaft und gerade die Studentenschaft war Träger dieser revolutionären Ideen, von demokratischen Gedanken, konstitutionellen Gedanken, mit Ideen für neue Verfassungen, Lehr- und Lernfreiheit und so weiter. All das kam auf und das hat der Metternichsche Staat natürlich mit Misstrauen beobachtet. Und er hat in dieser Zeit dann sukzessive eine deutsche Universität nach der anderen auf eine Liste gesetzt und gesagt 'Da darf man als Kind der Monarchie nicht studieren'. Und 1819 hat man alle deutschen Universitäten auf diese Verbotsliste gesetzt und damit war aber auch ein Anlass gegeben, eine evangelische Fakultät zu gründen - und 1821 ist sie dann auch wirklich gegründet worden."
Das Ziel der Lehranstalt war gewissermaßen ein bescheidenes und ein großes zugleich: Es ging darum, Prediger und Pfarrer auszubilden – und dies nicht etwa im liberalen Geiste, der Freiheit eines Christenmenschen entsprechend, sondern mit einem streng kontrollierten Curriculum, auf dass jeder revolutionäre, aufrührerische Geist gleich im Keim erstickt werde. Zugleich aber war das Einzugsgebiet ein riesiges – umfasste es doch alle Länder der Habsburgermonarchie.
"In dieser Lehranstalt war in den ersten Jahrzehnten ein Lehrkörper an den Kathetern, die in der Regel aus dem Königreich Ungarn oder Siebenbürgen stammten, von den dortigen wirklich angesehenen und berühmten Gymnasien mit einem hohen Standard in den alten Sprachen. Von dort kamen oft Direktoren oder Rektoren zum Zug, die dann berufen wurden. Das waren honorige, rechtschaffene Schulmänner, die aber natürlich nicht das Niveau der evangelisch-theologischen Fakultäten in Deutschland repräsentieren konnten, wo die Theologie in hoher wissenschaftlicher Blüte stand. Das änderte sich erst mit der Thun-Hohenstein'schen Universitätsreformen 1849. Dort hat der Staat diese Reformen auch auf die Lehranstalt übertragen und ihr die entsprechenden Vorschriften gemacht, auch hier zu modernisieren, was sie sehr gern getan hat. Die evangelischen Theologen waren auch Anhänger der Revolution und haben sich da sehr engagiert, auch die Studenten."
Im Laufe des 19. Jahrhundert erlebte die Fakultät dann einen enormen wissenschaftlichen Aufschwung. Das wissenschaftliche Personal war etabliert und sorgte für wachsendes Renommee. Einzige strukturelle Hürde: Die Fakultät war – auch wegen des Widerstandes der katholischen Fakultät – weiterhin nicht vollständig in die Universität integriert.
"Und bei ihrer Hundertjahrfeier 1921 hat man deshalb auch Druck gemacht, auch in der Öffentlichkeit, durch die ganze Organisation der Feier, dass man doch endlich in die Universität aufgenommen wird. 1922 in einer bestimmten politischen Konstellation, wo eine bestimmte Koalition nur dann möglich wurde, war es dann möglich, dass die evangelisch-theologische Fakultät eine eigene Fakultät der Universität Wien wurde. Seit 1921 ist das der Fall, aber das musste sich die Fakultät erkämpfen und ist historisch gesehen, das muss man auch sagen, sehr spät."
Die Weltkriege: Einschnitte in der Geschichte der ETF
Die beiden Weltkriege markierten auch für die evangelische Fakultät einen massiven Einschnitt. In der ersten Kriegseuphorie 1914 stellte etwa ein Student den Antrag, dass evangelische Studierende sich freiwillig zum Kriegsdienst melden sollten.
"Das ist insofern bemerkenswert, als evangelische oder überhaupt alle Theologen vom Militärdienst befreit waren per Gesetz. Damals gab es ungefähr 80 Studierende, das waren dann über 50 Deutschsprechende, dann an die 20 Tschechen. Man kam zu einem Kompromiss, indem man gesagt hat, ja, man könne sich auch zum Sanitätsdienst melden. In der Folge sind aber dann doch 50 Studierende in den Ersten Weltkrieg gezogen. Man musste dazu erst einmal die Bewilligung des Oberkirchenrates einholen, dann noch des Landes Verteidigungsministeriums, damit dieses Gesetz aus der Welt geschafft wird. Und man hat einen Erlass tatsächlich veröffentlicht, dass die evangelischen Theologen das nun dürfen. Und sie sind dann schon zwei Monate später etappenweise in den Krieg gezogen. Die Folge für die Fakultät war natürlich verheerend. Das hat sie letztlich bis ins Mark getroffen. Der Lehrbetrieb kam damit eigentlich zum Erliegen. Und noch im Sommersemester 1915 wurde wieder der Lehrbetrieb an der Fakultät geschlossen. Ungefähr ein Fünftel der Studierenden ist gefallen. Aber man muss erst einmal, ja, wie soll man das formulieren, diesen Vorgang vorstellen, dass eine ganze Generation von Theologen in den Krieg zieht und im Grunde genommen gezeichnet zurückkommt."
Nach dem Ende der Monarchie fungierte die Fakultät als sogenannte "Grenzlandfakultät", d.h. sie fand ihre Rolle als eine Ausbildungs- und Wissenschaftsstätte, die für die deutschsprachige evangelische Diaspora zuständig war. Das Dritte Reich wollte sich dieses Konzept zunutze machen und die Fakultät zu einer Art Trutzburg oder theologisches Bollwerk gegen den Osten entwickeln. Das Konzept wurde dann aber fallen gelassen, als die NS-Kirchenpolitik entschloss, das Christentum insgesamt als Gefahr anzusehen und zu bekämpfen. Nach Kriegsende stand die Fakultät wieder vor der Herausforderung, geeignetes Personal zu finden und sich auf das wissenschaftliche internationale Niveau hochzuarbeiten. Der Kraftakt gelangt mit Bravour – und so steht die Fakultät heute stark und gut ausgestattet da. Noch einmal der Kirchenhistoriker Rudolf Leeb:
"Wir alle sind uns einig, dass wir auch mit diesem Jubiläum einfach zeigen wollen, welches Niveau evangelische Theologie hat; und das gerade in Zeiten der Globalisierung, wo religiöse Fragen im christlichen Bereich Pfingstbewegung, in Erweckungsbewegung und Evangelikale, ja überhaupt in einer Zeit, in der religiöse Motive, islamischer Fundamentalismus und dergleichen mehr eine wichtige Rolle spielen. Dass es da Leute braucht, die sich mit diesen Fragen schlicht auskennen und zwar wissenschaftlich auskennen und hier auch mit solchen Leuten wissenschaftlich oder konkret in Augenhöhe sein können, dass die sich verstanden fühlen und dass die auch einen Konterpart haben. Die Wissenschaft oder auch die Gesellschaft ist Theologie-bedürftig."
Wissenschaft aus evangelischem Ethos
Damit ist der Boden der Gegenwart betreten und die Frage nach der Zukunftsfähigkeit evangelischer Theologie steht im Raum. Gibt es eine eigene Art, evangelisch Theologie zu betreiben? Gibt es nicht nur eine eigene evangelische Kultur, sondern auch eine eigene Wissenschaftstradition? Der Wiener evangelische Neutestamentler, Prof. Markus Öhler, sagt 'Ja', die gibt es:
"Es ist ja so, dass die protestantische Tradition, Wissenschaft zu treiben, sich von der katholischen durchaus unterscheidet. Ich kann das jetzt für mein Fachgebiet, ich bin Neutestamentler, eigentlich ganz gut darstellen daran, dass die biblischen Traditionen in der Reformation natürlich eine enorme Bedeutung haben in der Theologie. Und die haben sie in der katholischen Tradition durchaus nicht in diesem Ausmaß gehabt bzw. erst seit dem Zweiten Vatikanum kommt es deutlicher zum Tragen. Und da spielt unsere Fakultät in Österreich schon eine wichtige Rolle, gerade auch in der Exegese der Bibel, dass wir zeigen können: so kann man das machen, mit einem kritischen Blick auf die Dogmatik wie auf die Rekonstruktion der Geschichte mit einem kritischen Blick Exegese zu treiben. Das machen wir, das machen inzwischen auch die katholischen Kollegen und Kolleginnen und machen das auch sehr gut. Aber wir haben da noch ein bisschen anderen Zugang, der eben nicht durch die Kirche so stark geprägt ist, sondern sehr stark auf der geisteswissenschaftlichen Wissenschaftstradition basiert, die eben in protestantischer Überzeugung gemacht wird."
Eine Wissenschaftstradition, die sich betont liberal geriert, die kein Lehramt kennt, sondern Synoden und Synodenbeschlüsse als Ausfluss protestantischer Debattenkultur. Eine Wissenschaftstradition auch, die dem ganzen Komplex Kirche eher kritisch gegenübersteht.
"Aber Theologie, finde ich, hat diese Aufgabe, im Protestantismus, dieses kritische Gegenüber zu sein, wirklich die Leute auch kritisch zu hinterfragen: Woher habt ihr das? Wie kommt das zustande, eure Ansicht? Ich glaube, das können wir ganz gut. Da haben wir jetzt in Österreich schon 200 Jahre Tradition. Das haben wir manchmal besser und schlechter gemacht. Es gibt auch Phasen, wo ich sagen würde, da haben wir das ziemlich vergessen. Aber ich glaube, das ist gegenwärtig wirklich so eine wichtige Aufgabe ist, das zu tun und das nicht nur gegenüber der Kirche, sondern natürlich auch gegenüber der Gesellschaft, diese kritische protestantische Perspektive einzubringen."
Kritik – das verbindet wohl katholische wie evangelische Theologie – kommt indes in nicht geringem Maße von innen: In beiden Kirchen gibt es nämlich Stimmen, die kritische Theologie eher als Gefahr sehen denn als Bereicherung. In den evangelischen Kirchen haben diese Traditionen einen eindeutigen Namen:
"Dieser evangelikal-fundamentale / fundamentalistische Geist ist in den 60er 70er Jahren aus Deutschland rübergekommen, als man Pfarrer geholt hat, die in solchen Ausbildungsstätten gewesen sind und das jetzt hier stark verankert haben. Und es gibt Gemeinden, die total davon geprägt sind, die auch wirklich sich organisieren zu einer Art Christus-Bewegung und versuchen da, eine andere Form von Ausbildung für ihre Pfarrer zu bekommen, die mehr ihrem Glauben entspricht. Es ist eine Herausforderung - man muss dann auch immer sagen: das ist eigentlich nicht die Tradition der Wissenschaftlichkeit im Protestantismus, die vorherrschend ist. Und wir müssen da immer wieder kämpfen und ihnen zeigen, dass diese Spannung, die zwischen dem denkerischen Nachvollzug des Glaubens und dem Glauben selbst besteht, dass das aushaltbar ist, dass das sogar fruchtbar gemacht werden kann. Die bezweifeln das aber leider oft."
Gelingende Kooperation mit katholischen KollegInnen
Wie sieht Öhler nun auf seine katholischen Kollegen? Betreffen theologische wie kirchliche Entwicklungen innerhalb der katholischen Kirche auch die evangelische Kirche und Theologie? 'Ja', sagt Öhler:
"Es ist natürlich schon spannend zu sehen, dass die Fragestellungen, die dort total en vogue sind und seit Jahrzehnten diskutiert werden, ohne dass man die Aussicht hat, es wird sich irgendwas verändern, dass das bei uns kalter Kaffee ist, wir interessieren uns eigentlich nicht dafür. Und zugleich ist es natürlich auch bei uns so, dass jetzt uns die Glaubenden nicht die die Kirchentüren einlaufen, sondern dass der Rückgang an Mitgliedern im Grunde genauso ist wie in der katholischen Tradition. Interessanterweise auch statistisch angeblich so, dass immer, wenn die katholische Kirche irgendeinen Skandal hat, wir auch mehr Mitglieder verlieren, weil auch unsere Mitglieder nicht immer ganz genau wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Also wenn dann so Gründe kommen wie die Unterdrückung der Frau, dann fragt man sie dann schon ..."
Die Kooperation innerhalb der Fakultät gestalte sich im Übrigen sehr gut, so Öhler. Seit die Fakultäten in der Schenkenstraße unter einem Dach sind, habe sich das noch deutlich intensiviert. Ein Symbol dafür ist etwa die gemeinsame Doctoral School, die Mitte November eröffnet wird.
"Das Jubiläum und die Feier des Jubiläums, die Einbindung der Universität, aber auch die Öffentlichkeit dazu soll auch dazu führen, dass das stärker wahrgenommen wird: Wir sind ein integrativer Teil der Universität, wir können da wirklich was dazu beitragen. Hoffen wir mal, dass das klappt. Ich bin optimistisch, dass das gelingt."
Die Festtage, mit denen vom 7. Bis 10. Oktober das 200-Jahr-Jubiläum der Fakultät gefeiert wurde, war ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass das gelingt, dass die Botschaft ankommt. In unserem nächsten Podcast werden wir uns daher noch einmal intensiver damit auseinandersetzen, worin die Referentinnen und Referenten und Teilnehmer der Veranstaltung das Zukunftspotenzial der evangelischen Theologie in Wien sehen. Bis dahin sagt Henning Klingen herzlichen Dank fürs Zuhören – bleiben Sie uns, bleiben Sie "Diesseits von Eden" gewogen.