Braucht die digitale Welt Regeln? - Und wenn ja, welche?
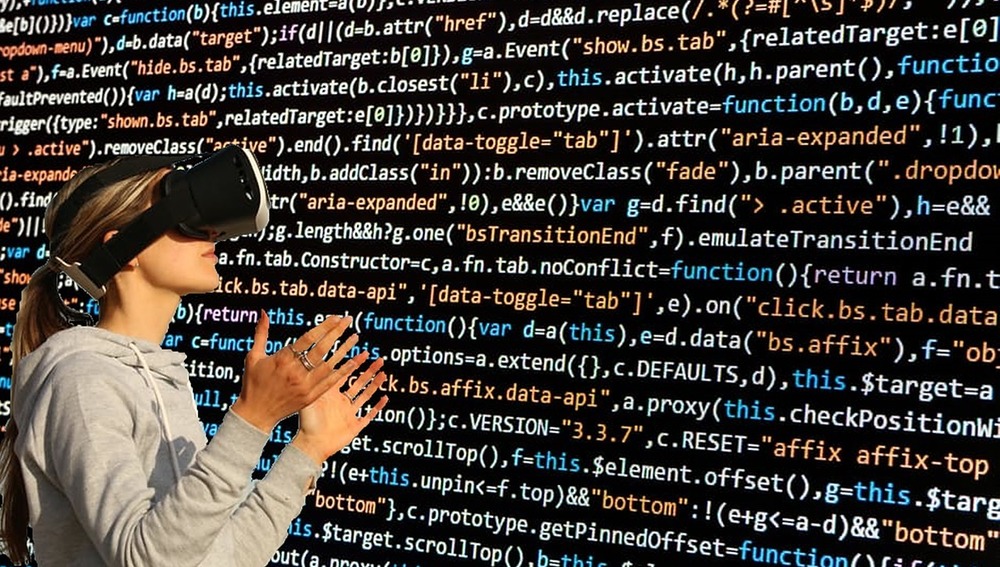
Foto: pixabay.com / CC0 public domain
Podcast vom 30. September 2025 | Hinweis: Transkript gekürzt! | Gestaltung: Henning Klingen*
Wenn Sie morgens aufstehen und unterwegs zur Arbeit am Handy durch die News des Tages wischen, werden Sie diese passgenau vom Algorithmus bekommen. Wenn Sie durchs Internet surfen oder Social-Media-Kanäle nutzen, werden Ihre dortigen digitalen Fußabdrücke penibel ausgewertet, um Ihnen noch bessere Angebote machen zu können. Und wenn Sie abends ins Bett fallen, dann mahnt die Smartwatch Sie womöglich, noch rasch ein paar Turnübungen zu machen, da sonst Ihr Body-Mass-Index aus dem Gleichgewicht kommt.
Das alles ist kein Science-Fiction, sondern die Realität in einer digitalen Welt. Eine Welt, die nicht wenige Menschen heutzutage schon stresst und immer häufiger auch sorgt. Spätestens seit das Sprachmodell ChatGPT seinen Siegeszug angetreten hat und zu Lauterem wie auch Unlauterem verwendet werden kann, ist wohl jedem und jeder klar: So ganz ohne Regeln wird es in dieser schönen neuen digitalen Welt nicht gehen.
Das haben sich auch 16 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem gesamten deutschen Sprachraum gedacht und Ende September in Wien "Zehn Regeln für die digitale Welt" präsentiert. Man könnte vielleicht auch von zehn Geboten für die digitale Welt sprechen. Schließlich ist einer ihrer Initiatoren der Innsbrucker Theologie-Professor Johannes Hoff. Grund genug also, dass wir hier auch bei "Diesseits von Eden" uns mit diesen Regeln befassen. Mein Name ist Henning Klingen und ich begrüße eben jenen Johannes Hoff hier im Podcaststudio gemeinsam mit Christoffer Coenen, Politikwissenschaftler am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie.
Vielleicht mal ganz persönlich zum Start: Wie gestaltet sich denn die Nutzung dieser Tools der digitalen Welt bei Ihnen beiden persönlich?

Prof. Johannes Hoff
Hoff: Ich kann nur biografisch antworten: Als ich 2007 in Großbritannien zu lehren begann, habe ich früh Facebook kennengelernt, Bilder gepostet, mit Studierenden kommuniziert und wusste genau, wer meine Freunde sind. Später kam Instagram dazu. Doch ab 2014/15 war kaum mehr überschaubar, wer meine Postings sah und welche Inhalte mir angezeigt wurden. Heute wissen wir, dass das durch Algorithmen gesteuert wird. Dieses Gefühl der Fremdbestimmung wurde mir unheimlich. Um 2017 stieg ich aus und nutze seither kaum soziale Netzwerke. Bei einer USA-Reise musste ich im ESTA-Formular Social-Media-Konten angeben und fürchtete fast, dass "keine" ein Problem sein könnte. Zwar nutze ich Signal mit wenigen Kontakten und viel E-Mail, aber soziale Medien habe ich verlassen. Digitale Technologien verwende ich in der Forschung intensiv, nicht nur als Thema, sondern als Werkzeug.
Coenen: Ich war nie Computerfreak, hatte aber schon Mitte der 80er einen Rechner und war sogar vor dem World Wide Web im Netz. Damals erlebte man die Pioniere, die ein anderes Verständnis hatten. Bis zu den Weblogs war ich euphorisch, dann ließ mein Interesse nach. 2020 ging ich zu Twitter, weniger zum Mitmachen, mehr um die ideologische Wirkung zu analysieren. Plattformen wie Twitter schüren Konfrontation, sind Tummelplätze für Verschwörungstheorien, weil diese Aufmerksamkeit bringen. Ich habe mich zurückgezogen – ins "Erholungsheim" von Twitter: Bluesky. Eigentlich halte ich Mastodon im Fediverse für die bessere Alternative, weil dezentral, aber vielen fehlt dort der Suchtfaktor.
Wenn wir uns Ihren Regeln nähern, dann könnten kritische Stimmen sagen: Da sitzen - mich eingeschlossen - jetzt drei mittelalte Männer, die einfach in einen gewissen Kulturpessimismus ihres mittleren Alters hineinkippen. Was sagen Sie dazu? Ist Kulturpessimismus eine angemessene Haltung der digitalen Welt gegenüber?
Hoff: Ich sehe mich als Kulturoptimist. Mein Vorbild ist Marshall McLuhan, der Medien als Chance sah, nicht als Schicksal. Ich glaube an Fortschritt, aber nicht an Automatismen. Fortschritt heißt: Zukunft gestalten, das Ende besser machen als den Anfang. „Sonst verlierst du den Anschluss“ ist falscher Fortschritt. Wirklicher Fortschritt ist wertegetrieben, und Technologien müssen diesem Design folgen. Viele Menschen "gehen nur mit der Zeit". Walter Kasper sagte: Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Coenen: Mich beschäftigt, dass technischer Fortschritt mit reaktionären Tendenzen einhergeht – Namen wie Musk oder Thiel stehen dafür. Ich komme aus einer sozialistischen Tradition, sehe aber nur noch Gadgets, die Nutzer entmündigen. Viele „Digital Natives“ haben erschreckend wenig Wissen über die Infrastruktur. Gleichzeitig ist es für mich immer noch überwältigend, dass ich in der Hosentasche Zugang zu Weltwissen habe. Doch wie so oft in der Technikfolgenabschätzung: große Chancen gehen mit gesellschaftlichem Rückschritt einher.
Zur Entstehung der "Zehn Regeln"
Wenn wir jetzt auf diese zehn Regeln schauen, dann denkt man vielleicht als religiös musikalischer Mensch an die Zehn Gebote... Wie kam es denn zur Ausformulierung dieser Regeln?
Hoff: Ausgangspunkt war, dass meine Frau Sarah Spiekermann und ich über die Erfahrung nachgedacht haben, dass man, wenn man auf Konferenzen geht, ständig Leute trifft, die Präsentationen machen mit Science Fiction-Stories. Und dann haben wir gemerkt: es gibt auch andere Kollegen, die diese Erfahrung machen. Das sind Spezialisten im Bereich der Neurowissenschaft, Gehirnforschung, Informatik, und die machen die Erfahrung, dass auf Konferenzen zunehmend Geschichten erzählt und "verkauft" werden, die nicht mehr wissenschaftlich gedeckt sind. Wir wollten diese Stimmen bündeln. Und anstatt wie in großen Firmen üblich topdown formulierte Kataloge (Fairness, Security etc.) zu wiederholen, entwickelten wir eine Art Checkliste: Keine starre Vorschrift, sondern ein Instrument, Probleme sichtbar zu machen. Und so ähnlich funktionieren auch die Zehn Gebote. Die sagen nicht, das und das sollst du tun, sondern die sagen, wenn du in bestimmten Tätigkeitsfeldern bist, geh mal diese Checkliste durch. Wenn man z.B. Technologie gestaltet, sie in Schulen einführt oder im Alltag nutzt, kann man anhand der Regeln prüfen, wo etwaige Gefahren liegen. Die Regeln verschaffen so die Autorität, "Nein" zu sagen und andere Wege zu wählen.
"10 Regeln für die digitale Welt"
|
Coenen: Unsere Gesellschaft hat tatsächlich ein unvernünftiges Technikverhältnis: Technik wird als Erlösungsmittel gesehen. Ich befasse mich inzwischen nicht nur mit praktischen Fragen der Technikfolgenabschätzung, sondern auch mit etwas, das man früher Ideologiekritik genannt hat. Und das scheint immer wichtiger zu werden, wenn man bedenkt, dass wir auf einmal die Situation haben, dass Religion auch selbst im Herzen des Westens in den USA auf eine ganz dubiose Weise politisch instrumentalisiert wird. Und da finde ich jetzt auch unseren Arbeitszusammenhang sehr spannend, weil ich glaube, dass dies eine Auseinandersetzung ist, die viel Sachkompetenz in religiösen Fragen verlangt und auch das Christentum berührt.

Christopher Coenen
Hoff: Ein Beispiel: die Gebets-App "Hallow". Auf den ersten Blick harmlos – Anleitungen zum Gebet, Stundengebet. Doch problematisch wird es, wenn Daten unsicher sind und Verhaltensmanipulation möglich wird. Nutzer werden in Abhängigkeiten gedrängt. Auffällig: Finanziert wird die App von Investoren wie Peter Thiel, bekannt durch Palantir. Religiöse Daten werden so verarbeitet, dass sie Erwartungen spiegeln und letztlich in Idolatrie kippen. Der heilige Augustinus würde sagen: Wer das Spiegelbild seiner selbst anbetet, verfällt dem Götzendienst. Es gibt den alten Spruch "Der Mensch denkt und Gott lenkt". Und heute haben wir die Situation "Der Mensch denkt und betet. Und der Krämer lenkt". Und der Krämer heißt in dem Fall Peter Thiel oder wer auch immer dahintersteckt. Unsere erste Regel lautet daher: "Erhebt Technik nicht zum Selbstzweck" – analog zum ersten Gebot. Wir brauchen Verfahren wie Value-Based Engineering und vielleicht kirchliche Prüfverfahren, eine Art "Imprimatur" für digitale Technik. Technologie ist nicht per se schlecht – auch gute Gebetsapps sind möglich, aber nur, wenn sie überprüft und vertrauenswürdig sind. Und so eine Stelle im Vatikan könnte Apps zum Beispiel nach dem Vorbild der "Zehn Regeln" checken und ein Prüfsiegel vergeben nach dem Motto: "Wenn du diese App benutzt, kannst du darauf vertrauen, dass Gott dich lenkt und nicht ein Krämer".
Bewusst breiter Adressatenkreis
Aber was ich mich gefragt habe: Wer ist eigentlich der Adressat der Zehn Regeln? Vom Duktus her sprechen sie ein kollektives "ihr" an. Wer ist damit gemeint? Jeder Einzelne? Firmen? Staaten bzw. die Politik?
Hoff: Die Regeln sind wie die Zehn Gebote minimal und universell zugleich. Darin liegt ihre Stärke. Genau wie bei den Zehn Geboten, die auch nicht einfach Regeln sind, die für einen Verein oder dessen Mitglieder gelten; jeder darf sich davon angesprochen fühlen und an seinem Platz darüber nachdenken, was sie hier und jetzt bedeuten. Designer sollten etwa keine Ich-Pronomen für KI-Modelle nutzen. Nutzer sollten Maschinen nicht vermenschlichen oder gar heiraten können. Entscheidend ist, dass der Unterschied zwischen Mensch und Maschine nicht eingeebnet wird. Das kann ich auf ganz verschiedenen Ebenen durchdeklinieren. Daher ist auch der Adressat nicht festgelegt.
Coenen: Das Spannende an den zehn Regeln ist, dass wir da durch einen intensiven Diskussionsprozess zu etwas gekommen sind, hinter dem wir alle stehen; die auch so formuliert sind, dass sich da sehr viele Leute wiederfinden können. Diese Unbestimmtheit ist also Absicht. Einzelne, Entwickler, Gesellschaften – alle können sie anwenden. Anlass war auch die Entwicklung in den USA. Bei uns steht keiner im Verdacht, einen Anti-Amerikanismus zu pflegen, aber man muss es deutlich sagen: Hinter dem Ruf nach Ersetzung des Menschen steckt oft ein Angriff auf Demokratie. Figuren wie Thiel oder Andreessen wollen unsere Gesellschaftsordnung überwinden. Umso wichtiger ist, dass demokratische, humanistische, konservative wie progressive Strömungen gemeinsam reagieren und unser Erbe nicht den Tech-Ideologen überlassen.
Hoff: Über Demokratie haben wir in der vierten Regel gesprochen. Sie betrifft die soziale Kompetenz. Und diese leidet unter dem Eindruck ständiger Mediennutzung merkbar. Etwa, wenn Schüler auf dem Pausenhof nur noch per WhatsApp miteinander kommunizieren oder beim Restaurantbesuch alle auf die Bildschirme starren: Solche Praktiken zerstören Diskursfähigkeit. Demokratie lebt aber von Gesprächs- und Streitkultur.
"Ein starkes Statement gegen die Verblödungsmaschinerie"
Wie glauben Sie denn, dass es mit diesen zehn Regeln weitergeht? Wie sollen sie sich ins kollektive Bewusstsein hineinschreiben?
Hoff: Sie lassen sich nicht einfach verbreiten, sondern eher einüben – etwa wie eine Checkliste. Wer die Regeln kennt, kann sie in konkreten Situationen abrufen und prüfen: Was bedeutet das hier für mich? Unterschiedliche Menschen werden unterschiedliche Antworten finden. Aber das Gespräch darüber wird angeregt. Selbst Alltagskontexte können Anlässe sein, über Technikgestaltung anhand dieser Regeln zu diskutieren. So sickern sie allmählich ein.
Coenen: Ich war zu Beginn tatsächlich skeptisch, ob aus unserem Diskurs etwas Brauchbares entsteht. Doch das Ergebnis ist klar und offen genug, dass viele sich darin wiederfinden. Die Regeln adressieren nicht nur akademische Lebenswelten, sondern auch Arbeitsrealitäten – etwa in Logistik oder Industrie, wo Algorithmen und Automatisierung massiven Druck ausüben. Und die ersten Rückmeldungen zeigen: Viele empfinden die Regeln als humanistisches, starkes Statement gegen die Verblödungsmaschinerie der Aufmerksamkeitsökonomie. Die Stärke liegt darin, dass sie in Alltag, Politik und Wissenschaft gleichermaßen nutzbar sind. Wer sie ernst nimmt, setzt ein Zeichen des Widerstands, indem er auf gemeinsame Werte rekurriert.
"Ein starkes Statement": Das ist ein schönes Schlusswort. Wer diese "Zehn Regeln für die digitale Welt" nachlesen will, der findet Sie auf der Website der "Future Foundation". Vielen Dank fürs Zuhören sagt Henning Klingen.




